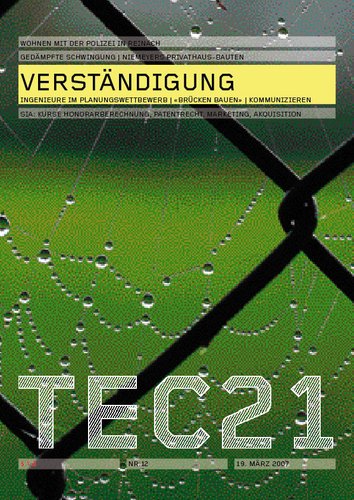Editorial
Editorial
«Man kann gleichwohl nicht sagen, dass man meint, was man sagt. Man kann es zwar sprachlich ausführen, aber die Beteuerung erweckt Zweifel, wirkt also gegen die Absicht. Ausserdem müsste man dabei voraussetzen, dass man auch sagen könnte, dass man nicht meint, was man sagt. Wenn man aber dies sagt, kann der Partner nicht wissen, was man meint, wenn man sagt, dass man nicht meint, was man sagt.»[1]
Besonders in hochspezialisierten Berufen wie im Bauwesen ist die Kommunikation entscheidend für das Gelingen eines Projektes. Zwischen den abstrakt-gestalterisch denkenden Architekten und den logisch-technisch orientierten Ingenieuren entstehen oft Sprachbarrieren durch fehlendes Vokabular und mangelndes Verständnis für das Gegenüber. Neben der unbeständigen Beteiligung am Projekt erschwert auch die prekäre Kommunikation zwischen den beiden Kulturen die Zusammenarbeit. Dass eine Zusammenarbeit in der Praxis dennoch gut funktionieren kann, zeigt das Beispiel der Gessnerbrücke in Zürich. Die Planenden im Team erreichten während Projekt und Umsetzung eine starke und gegenseitig befruchtende Vernetzung. Resultat ist eine fein ausgearbeitete Brückenlösung, die neben den funktionalen Anforderungen einer städtischen Verbindung auch eine gestalterische Idee umsetzt, die das Bauwerk mit seiner Umwelt vernetzt.
Auch wenn die momentane Honorarsituation Ingenieure nicht gerade zu einer Zusammenarbeit mit Architekten lockt, findet projektbezogen doch ein reger Austausch zwischen den beiden Berufen statt. Eine grundsätzliche Schwierigkeit ist immer noch die unterschiedliche Anerkennung der Leistungen von Architekten und Ingenieuren. Bei der Teilnahme an Wettbewerben ziehen Architekten – meist auch von der ausschreibenden Stelle so vorgegeben – Ingenieure und Fachplaner zu Rate. Bei der Prämierung der Projekte stehen aber meist die Architektur und die städtebauliche Lösung im Vordergrund. Die Ingenieurleistungen werden gar im Anschluss – je nach Schwellenwert – neu für die Ausführung ausgeschrieben. Der Autor des ersten Artikels weist auf diesen Missstand hin und sucht nach Lösungen für eine bessere gemeinsame Wettbewerbskultur. Katinka Corts, Daniela Dietsche
[1] Niklas Luhmann: Soziale Systeme. 12. Auflage, Suhrkamp Verlag 2006
Inhalt
Wettbewerbe
Neue Ausschreibungen | Wohnen mit der Polizei in Reinach
MAGAZIN
Gedämpfte Schwingung | Niemeyers Privathaus-Bauten
SIA
Kurse Honorarberechnung, Patentrecht, Marketing, Akquisition
ingenieure im planungswettbewerb
Tivadar Puskas
Architekten und Ingenieure entwickeln im Wettbewerb gemeinsam Projekte, für die Ausführung werden die Ingenieurleistungen meist neu vergeben. Ein Aufruf zur Förderung der Wettbewerbskultur
«brücken bauen»
Carlo Bianchi, Roman Züst
Am Beispiel der neuen Gessnerbrücke in Zürich beschreiben Ingenieur und Architekt gemeinsam den Ablauf und die Vorteile ihrer Zusammenarbeit.
Vernetztes kommunizieren
David J. Krieger
Können die Erfahrungen mit der interkulturellen Kommunikation dazu beitragen, die Verständigung zwischen verschiedenen Berufskulturen zu verbessern?
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Ingenieure im Planungs-Wettbewerb
Im Architekturwettbewerb entwickeln Architekten und Ingenieure gemeinsam Gestaltungs- und Tragwerkslösungen. Die Wege der beiden Berufsgruppen trennen sich dann aber meist, denn wenn es um die Ausführung des Projektes geht, müssen – je nach Schwellenwert – die Ingenieurleistungen neu vergeben werden. Ein Aufruf an die Architekten und Bauherrschaften, die Leistungen der Ingenieure anzuerkennen und damit die Wettbewerbskultur zu fördern.
Entsprechend der heute gültigen SIA-Norm 142 sind die Planungswettbewerbe ein wichtiges Instrument zur Auswahl einer funktionell, gestalterisch und ökonomisch optimierten Lösung für eine Bauaufgabe. Dazu gehört natürlich die Wahl des geeigneten Planerteams. Die SIA-Norm 142 regelt den rechtlich korrekten Ablauf des Wettbewerbsverfahrens unter Berücksichtigung der Situation im öffentlichen Beschaffungswesen durch den Beitritt der Schweiz zum GATT / WTO. Je nach Komplexität und Bedeutung der Aufgabe werden in der Praxis das offene respektive das selektive Auswahlverfahren oder das Verfahren auf Einladung durchgeführt. Wohn- oder Schulbauten zählen dabei oft zu den « einfacheren » Wettbewerbsaufgaben, bei denen der offene Wettbewerb zum Einsatz kommt. Spitäler und Bauten, die zur Kultur zählen, gehören zu den komplexeren Aufgaben, die meist mit einer Vorselektion beginnen.
Bei der Ausschreibung eines Architekturwettbewerbs wird den Architekten häufig empfohlen, Fachingenieure als Berater oder Spezialisten beizuziehen. In den Beurteilungskriterien für die Jurierung werden entsprechend neben der Gestaltung der Baukörper konstruktive Kriterien der Nutzungsflexibiltät und des statischen Konzeptes sowie Aspekte der Nachhaltigkeit der
energetischen und ökologischen Lösungen bewertet. Besonders werden die Ingenieure, die sich für gute Architektur und innovative Tragwerkslösungen respektive haustechnisch innovative Konzepte einsetzen, von den Architekten angefragt, an Architekturwettbewerben teilzunehmen und einen Beitrag zum Wettbewerbsprojekt zu leisten. Sie arbeiten mit dem Architekten und den Fachplanern aus den Bereichen der Haustechnik einen Vorschlag aus, bei grösseren Wettbewerbsprogrammen kann dies in Form von Workshops oder mehreren Besprechungen geschehen. Das daraus resultierende Projekt sollte einen maximalen Nutzen für die Gesellschaft unter Berücksichtigung der technischen, ökonomischen und ökologischen Anforderungen darstellen.
Beteiligung an der Planung
Die Aufgabe des Ingenieurs besteht dabei nicht primär im Berechnen der Deckenstärke oder der Wandbewehrung. Vielmehr geht es im Architekturwettbewerb darum, gemeinsam ein Tragwerkskonzept zu finden, das den architektonischen Ausdruck stärkt und den Nutzeranforderungen entspricht. Die Ingenieursleistung im Wettbewerb ist manchmal auf den ersten Blick ablesbar, oft aber auch nicht. Bei Projekten mit weit gespannten Dächern oder grossen, stützenfreien Räumen ist sie aufgrund der Wahl der eingesetzten tragenden Bauteile und des gewählten Bauablaufs schnell ersichtlich. Auch bei kleineren Projekten klären Architekten Fragen zur räumlichen Konzeption der tragenden und stabilisierenden Bauteile sowie zur Materialisierung mit Ingenieuren, deren Leistung ist später aber im Projekt nicht vordergründig ablesbar. Dabei werden gemeinsam die Art und Anordnung der stabilisierenden Elemente in Form von Kernen, aufgelösten Wandscheiben, Rahmen oder Fachwerken in der Fassade diskutiert. Die Decken können je nach Spannweite beispielsweise als Flachdecken, Leichtbaudecken, Unterzugs- oder Überzugsdecken ausgebildet werden. Die vertikalen Tragelemente können als Stützen oder Wandscheiben eingesetzt werden. Wenn die Fassaden und damit auch die vertikal tragenden Bauteile zwischen den Geschossen nicht übereinander liegen oder wenn ganze Gebäudeteile stützenfrei ausgebildet werden sollen, ist der Kräfteverlauf von zentraler Bedeutung. Die im Team gewählte Materialisierung der tragenden Bauteile spielt bei jedem Projekt eine wesentliche Rolle. Sie hat einen wichtigen Einfluss auf die Wahrnehmung und resultiert aus der Beanspruchung der Bauteile. Je nach Aufgabe ist eine Vorfabrikation der tragenden Bauteile angebracht. Bei Wettbewerben ist auch die Verkehrsführung im städtischen oder ortsgebundenen Kontext ein wichtiger Punkt. Oft liegen Parkplätze unterhalb des Gebäudes, die Gebäudelasten müssen dann auf geschickte Weise in die Parkstützen eingeleitet werden. Gerade der spielerische Einsatz der Tragwerkskonzepte, im Kontext mit dem architektonischen Ausdruck und dem Haustechnikkonzept, gehört zu den spannendsten Aufgaben der Ingenieure.
Förderung der Zusammenarbeit
Mit diesen Erläuterungen wird deutlich, dass der Beitrag des Ingenieurs bei der Entwicklung eines Bauwerks immer wesentlich und nach dem Wettbewerb nicht einfach austauschbar ist. Der Architekturwettbewerb ist, wie eingangs erwähnt, ein Mittel zur Wahl des Planers für die Lösung einer Bauaufgabe. Bei einem erfolgreichen Wettbewerbsprojekt sollte daher nicht nur der Architekt, sondern mit ihm das ganze Planerteam prämiert werden. Die bessere Beurteilung der Ingenieurbeiträge könnte durch ein kompetentes Preisgericht mit einem Ingenieur als Fachpreisrichter oder als Experten erfolgen.
Die Ingenieure sollten bereits im Architekturwettbewerb innovative, im Gesamtkontext stehende Tragwerke entwickeln. Somit können auch sie einen wichtigen Anteil zur Entwicklung der Wettbewerbs- und Baukultur in der Schweiz leisten. Nicht zuletzt sind solche Beiträge Bausteine zur Förderung des Images des Ingenieurberufsstandes und damit auch der Nachwuchsförderung. Die Bauherrschaften könnten ihren Beitrag leisten, indem sie auch die Leistungen der Ingenieure im Wettbewerb beurteilen und würdigen würden. Das Abtreten von Urheberrechten der Fachingenieure ist dabei rechtlich zwar unter gewissem Aufwand möglich, es ist aber sicher nicht der richtige Weg, um die Wettbewerbskultur zu fördern. Bei einem gewonnenen Architekturwettbewerb sollte dann das ganze Planerteam mit der weiteren Planung beauftragt werden, da die intellektuelle Leistung selten von einem Partner allein bestimmt wird, sondern vom gesamten Team.TEC21, Mo., 2007.03.19
19. März 2007 Tivadar Puskas
«Brücken bauen»
Dass verschiedene Fachdisziplinen getrennt planen, gehört zunehmend der Vergangenheit an. Am Beispiel der neuen Gessnerbrücke in Zürich beschreiben Ingenieur und Architekt gemeinsam den Ablauf und die Vorteile einer Zusammenarbeit, die beim Wettbewerb beginnt und bei der Übergabe des Bauwerks an die Bauherrschaft endet.
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Verknüpfung hat die Architektur schon länger – und etwas verzögert auch den Brückenbau – die Domäne des Bauingenieurs erreicht. Die Verdichtung des Raums hat gleichzeitig die Komplexität neuer Brückenbauten erhöht. In Städten und Dörfern stehen Gebäude und Brücken teilweise in fast erdrückender Nähe zueinander. Deshalb ist Brückenbau heute nicht vorwiegend eine technische, sondern gleichwertig eine städtebauliche und raumplanerische Auseinandersetzung mit engen Rahmenbedingungen. Dadurch hat die Zusammenarbeit von Bauingenieuren und Architekten für neue Brücken erheblich zugenommen, was die zahlreichen Brückenwettbewerbe der letzten zehn Jahre bestätigen.
Als Reaktion auf diese Tendenz melden sich Stimmen, die der vergangenen Zeit etwas nachtrauern, als der Bauingenieur auch der Brückenarchitekt war. Natürlich ist das Neue nicht immer gut und besser als das Alte, das gilt auch für die interdisziplinäre Entwicklung im Brückenbau. Aber diese fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen Architekten und Bauingenieuren verlangt einerseits grundlegend, andererseits projektbezogen eine wesentlich tiefere Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung, was der Entwicklung im Brückenbau spürbar neue Impulse und neuen Schub verleiht.
Architekten neigen viel mehr als Ingenieure dazu, Bestehendes zu hinterfragen. Bauingenieure sind gefordert, bewährte, vor allem technische Grundsätze argumentativ zu verteidigen und offen für neue Aspekte zu sein. Gleichzeitig verlangt die Interaktion von den Architekten, ihre Grundsätze, die für den Entwurf von Hochbauten gelten, im Brückenbau zu überdenken und neu zu gewichten. Denn die Gestaltung von Brücken steht in einem anderen Verhältnis zu Machbarkeit, Dauerhaftigkeit, Wirtschaftlichkeit und Verhältnismässigkeit. Brücken werden nicht mit grundlegend anderen Zielen entworfen, ihre Prioritäten und Gewichtungen sind jedoch anders. In städtebaulicher Hinsicht können Brücken wie Hochbauten Räume bilden. Eine Analyse der Achsen und Wegverbindungen ist unumgänglich, um die Gestalt einer Brücke festzulegen. Anhand dieser Analysen wird festgelegt, ob sich die Brücke zurückhaltend in die bestehende Situation integriert oder ob man mit einer raumbildenden Tragkonstruktion neue räumliche Zusammenhänge schafft.
Die Gessnerbrücke in Zürich
Eine der jüngsten Brücken, die aus einem interdisziplinären Brückenentwurf hervorgegangen ist, ist die neue Gessnerbrücke in Zürich. Das Tiefbauamt der Stadt Zürich initialisierte einen zweistufigen Totalunternehmerwettbewerb, aus dem der Entwurf « Hirondelle » siegreich hervorging. Der Bauherr verlangte explizit, dass im Team ein Architekt vertreten sein muss. Die Gessnerbrücke liegt im Zentrum der Stadt, unweit des Hauptbahnhofs, und ist Teil einer wichtigen innerstädtischen Verbindung für alle Verkehrsteilnehmer.
Die neue Brücke ersetzt den Übergang von 1933. Sie hat weder spektakuläre Spannweiten noch andere prestigeträchtige Abmessungen oder Daten. Umso komplexer ist der planerische Spielraum: Die Gessnerbrücke befindet sich an einem wichtigen Ort für die Stadt Zürich, der sich in der Entwicklungsphase befindet. Unter dem Begriff « Stadtraum HB » sind mittel- und langfristig grössere Veränderungen in unmittelbarer Umgebung zu erwarten. Die Gessnerbrücke ist Teil des wiederentdeckten Naherholungsgebietes Sihlraum und soll offene Räume bieten, die neue Wegbeziehungen mit fussläufigen Verbindungen am Ufer unter der Gessnerbrücke hindurch schaffen. Somit gewinnt dieser Bereich an Bedeutung, auf die die Brücke vor allem auch mit ihrer Untersicht reagieren musste. Eine weitere Rahmenbedingung im Wettbewerb war, dass der Verkehr auch während des Baus nicht unterbrochen werden durfte. Insgesamt also eine herausfordernde Aufgabe mit städtebaulichem Gewicht, für die ein Team aus Bauingenieuren, Architekten und Unternehmer prädestiniert ist.
Gemeinsame Planung
Bereits im ersten Workshop fiel der Entscheid zwischen Stahlverbundtragwerk und Spannbetonkonstruktion einstimmig zugunsten des Letzteren. So wurde ein integrales, unterhaltsarmes Tragwerk ohne Lager und Fugen mit einer homogenen Konstruktion möglich. Zudem war die gleichmässige Wirkung der Untersicht im Kontext zum Sihlraum so besser zu realisieren.
Aus dem städtebaulichen Kontext und den noch unbekannten Entwicklungen vom «Stadtraum HB» heraus wurde der Grundsatz formuliert, dass das unten liegende Tragwerk zurückhaltend gestaltet und so der darunter liegende Sihlraum unmittelbar erlebbar werden sollte.
Die Frage nach einem zwei- oder dreifeldigen Tragwerk und der Querschnittsform der Brückenplatte wurde in mehreren Workshops behandelt. Die Architekten lieferten wertvolle Antworten zur Wahrnehmung des Raums unter der Brücke und zur Wahrnehmung des Übergangs vom Uferweg aus. Der Spielraum für die Gestaltung der Brücke blieb aber durch verschiedene Umstände – wie maximaler Hochwasserstand, Nutzung der Brücke und Bauweise – stark eingeschränkt. Die bestehende Gessnerbrücke hatte zwei Tragscheiben, die den Sihlraum in drei Tunnel teilten. Das Planungsteam wurde sich schnell einig, dass der neu begehbare und erfahrbare Sihlraum so wenig wie möglich kanalisiert und verbaut werden sollte. Erste wirklichkeitsnahe Visualisierungen der Architekten waren dabei wesentliche Entscheidungshilfen, die schliesslich zusammen mit den technischen Argumenten der Ingenieure (z.B. setzungsarme Fundation auf SZU-Tunnel) der zweifeldrigen Brückenplatte den Vorzug gaben. Mitentscheidend war, dass beim 2-Feld-Balken der Scheitelpunkt des Strassengefälles mit dem Standort des Pfeilers und der grössten Plattenstärke zusammenfiel. Die zweifeldrige Brücke wirkte im Vergleich zur dreifeldrigen Lösung deutlich schlanker und eleganter, die geschätzten Kostenunterschiede zwischen den Varianten waren unbedeutend.
Die einzige Lösung für eine schlanke Betonbrücke bei Spannweiten von 2 × 22 m ist die vorgespannte Platte. Aufgrund der beim Projektstart definierten Wirkung der Brückenuntersicht auf den Sihlraum wurden von Architekten und Bauingenieuren verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für den Plattenquerschnitt untersucht. Die Diskussion ergab den Wunsch nach einer wellenförmigen Untersicht, die eine unverkennbare Affinität zum Wasser und zur Fliessrichtung besitzt und damit positiv auf das Erlebnis des Flussraums einwirkt. Gleichzeitig bewirkt die Wellenform eine balkenartige Verstärkung, die auch statisch sinnvoll ist, da die grösste Plattenstärke mit den Stellen der maximalen Beanspruchung zusammenfällt. «Form follows function» wird in Längs- und Querrichtung gut umgesetzt. Die Mehrkosten der wellenförmigen Schalung belaufen sich auf etwa 1 % der gesamten Baukosten, was das gesamte TU-Team vertretbar fand.
Die Pfeilerform ist ein weiteres Element, das die Erscheinung der Brücke aufgrund der insgesamt reduzierten formalen Gestaltung umso stärker prägt. Ingenieure und Architekten vertraten anfänglich unterschiedliche Meinungen, welche Aussage die formale Gestaltung des Pfeilers erzielen soll. Die Architekten bevorzugten die ausgeführte Version: der Pfeiler als kräftige Auflagerscheibe, die sich den Wassermassen entgegenstemmt und daher formal zur Brückenuntersicht hin verjüngt werden muss. Der gesamte Baukörper tritt als gedrungener, flach über dem Wasser liegender Körper elegant und zurückhaltend in Erscheinung. Die Zusammenarbeit im Planungsteam der neuen Gessnerbrücke hat gut funktioniert. Das Resultat überzeugt sowohl die darin vertretenen Bauingenieure als auch die Architekten und den Bauunternehmer. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Entwurf geschah kollegial und mit konsequentem Blick auf die gesetzten Prioritäten und Ziele, sodass ein Bauwerk ohne Kompromisse entstand. Im übertragenen Sinn gilt auch hier die Aussage, dass das gemeinsam erzielte Ergebnis besser als die Summe der Einzelleistungen ist.
Der Entwurf einer Brücke kann aufgrund technischer und städtebaulicher Rahmenbedingungen zu einer komplexen Aufgabe werden, die von einem Team aus Bauingenieuren und Architekten gelöst werden sollte. Verschiedene gute Beispiele der vergangenen Jahre zeigen, dass ein effizientes und robustes Tragwerk und eine hohe gestalterische Qualität gut vereinbare Ziele sind, ohne dass sich erhebliche Mehrkosten ergeben. Die Kunst liegt darin, die Prioritäten bereits bei der Konzeptwahl richtig zu setzen. Somit kann eine gestalterisch gute Lösung sehr wirtschaftlich sein.TEC21, Mo., 2007.03.19
19. März 2007 Carlo Bianchi, Roman Züst