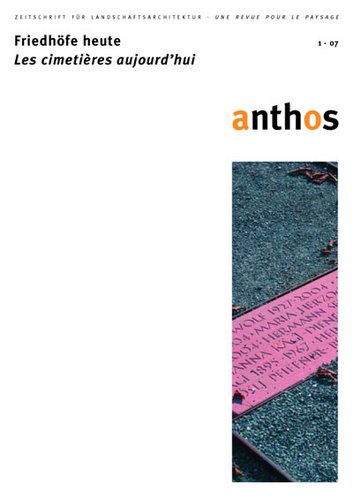Editorial
Seit dem letzten anthos-Themenheft über Friedhöfe (4/1998) hat sich vieles verändert. Konnten wir damals noch über die Anlage neuer Friedhöfe berichten, so sind es heute vor allem Umstrukturierungen bestehender Anlagen.
Bekannte Tendenzen haben sich verstärkt, und das nicht nur in Städten und Agglomerationen, sondern auch in ländlichen Gebieten. Es gibt immer weniger Erdbestattungen und immer mehr Kremationen (in Winterthur zum Beispiel 80 Prozent), die Bestattung in Gemeinschaftsgräbern nimmt weiter zu (Zürich hat heute 16 Gemeinschaftsgräber, der Anteil dieser Bestattungsform liegt über 30 Prozent), Wald- oder Baumgräber liegen im Trend. War die freiburgische Alp Spielmannda, auf der die Asche unseres langjährigen Redaktors Heini Mathys ruht, einst etwas Aussergewöhnliches, so etablieren sich heute immer mehr private Unternehmen, die Bestattungen ausserhalb öffentlicher Friedhöfe anbieten. Man kann sich entscheiden zwischen der Bestattung auf Wiesen, an Bäumen, an Felsen, dem Verstreuen der Asche in einem See oder einfach auch im Wind. Man kann auch seine Kuscheltiere begraben lassen.
Hinzu kommen zunehmend die Anforderungen nichtchristlicher – vor allem muslimischer – Religionen. Etwa 10 Prozent der Stadtzürcher Bevölkerung sind Muslime, die Zahl derer, die Verstorbene in ihre frühere Heimat zurückführen, wird immer kleiner; in der Schweiz Geborene werden auch hier beerdigt. Grössere und mittlere Städte richten eigene muslimische Grabfelder ein und finden Kompromisse bei der Art der Beisetzung.
Der Schwerpunkt dieses Heftes liegt – der Praxis entsprechend – bei den Gemeinschaftsgräbern. Das Spektrum der vorgestellten Anlagen ist nicht nur gestalterisch vielfältig. Die Beisetzung reicht von Sammelurnen über das Vergraben der Asche im Boden, mit oder ohne Urne, bis zum Gemeinschaftsgrab für Erdbestattungen. Namen und Jahreszahlen können auf Wunsch in peripheren Stein- oder Glasplatten, Skulpturen oder Metallstangen eingraviert werden.
Woher kommt eigentlich – in einer Zeit gesellschaftlicher Individualisierung – der Wunsch nach gemeinschaftlicher Bestattung? Welche «Gemeinschaft» suchen wir im Grab? Die der zufällig gleichzeitig Verstorbenen? Wohl kaum. Suchen wir hier überhaupt «Gemeinschaft»? Oder lösen wir uns nicht geradezu aus dieser heraus – aus den traditionellen sozialen Strukturen? Liegen die Gründe also im Zerfall der Familien, in der fehlenden Ortsverbundenheit, im Verlust kirchlicher Bindungen, in einem rituellen Vakuum? Oder suchen wir einfach nur die ökonomisch günstigste Lösung? Es gibt viele unbeantwortete Fragen. Auch die, ob dieser Trend wirklich anhalten wird.
So stellt sich schliesslich die ganz grundsätzliche Frage, welche der heute erkennbaren Entwicklungen sich in einer überschaubaren und planbaren Zukunft fortsetzen werden. Haben wir es auch weiterhin «nur» mit Veränderungen innerhalb unserer heutigen Friedhofsstrukturen zu tun? Oder müssen wir nach ganz neuen Formen suchen? Bernd Schubert
Inhalt
- Editorial
Matthias Krebs
- Erweiterung des Friedhofs Rickenbach ZH
Stephan Kuhn, Richard Truninger
- Umfrieden - Friedhofserweiterung Weiach
Christoph Schläppi
- Mystischer Hain
Meinrad Huber
- Gräber-Denkmalschutz und Nutzungsrecht im Kanton Zürich
Christoph Peter Baumann
- Bestattung von Nichtchristen
José Lardet
- Der Israelitische Friedhof „Au Bois de Cery“
Kerstin Gödeke
- Ein neues Gemeinschaftsgrab für Bolligen
Roman Berchtold
- Trauer und Trost - Neue Gemeinschaftsgräber in Zürich
Matthias Fahrni, Beat Breitenfeld
- Asche zu Asche - Gemeinschaftsgräber in Nunningen und Duggingen
Hans Klötzli
- Gemeinschaftsgrab für Erdbestattungen in Bern
Rudolf Lüthi, Jan Kaeser
- Neue Gemeinschaftsgräber im Appenzellerland
Jutta Hinterleitner
- Friedhöfe für eine neue Gesellschaft - drei Beispiele aus den Niederlanden
Paolo Bürgi
- Parco della Memoria, Mailand
Kerstin Gödeke, Wolfgang Fehrer
- Die Totenwelt Japans
Sabine Wolf
- Friedhöfe für Kuscheltiere
- Schlaglichter
- Mitteilungen des BSLA
- Mitteilungen des VSSG
- Wettbewerbe und Preise
- Schweizer Natursteine
- Agenda
- Literatur
- Markt
- Stellenmarkt
- Schweizer Baumschulen
- Produkte und Dienstleistungen
- Impressum
Bestattung von Nichtchristen
Immer mehr Menschen aus immer ferneren Ländern mit zum Teil für uns fremden Religionen bringen auch ihre Bedürfnisse an das Bestattungswesen mit.
Die Volkszählung im Jahr 2000 zeigte anschaulich die Veränderung der Religionslandschaft in der Schweiz. Die Immigration von Menschen aus immer ferneren Ländern macht sich bemerkbar. Nach Hochrechnungen auf der Basis der Volkszählung und eigenen Schätzungen gibt es nun in der Schweiz neben den traditionellen Volks- und Freikirchen 18000 jüdische und 140000 christlich-orthodoxe Mitbürger, 320000 sunnitische und schiitische Muslime, 30000 Aleviten, 30000 Hindus, 23000 Buddhisten und 5000 Menschen weiterer Religionen. Dies bringt mit sich, dass das Thema «Tod und Bestattung» immer aktueller wird. Mit Ausnahme der Juden sind alle anderen genannten Religionsgemeinschaften solche von Immigranten.
Bis vor Kurzem war die Bestattung von Menschen einer nichtchristlichen Religion (mit Ausnahme der Juden) in der Schweiz kaum ein Thema, weil die überwiegende Mehrheit der Verstorbenen in ihre Heimat überführt und dort bestattet wurde. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert. Immer mehr war für Immigranten die Schweiz nicht nur ein vorübergehender Aufenthaltsort. Weil die zweite und die dritte Generation hier aufgewachsen sind, wurde die Schweiz zur Heimat. Dies hat auf das Bestattungswesen seine Auswirkungen. Die Kinder möchten ihre Eltern oder andere Angehörige nicht in einem fernen Land, das für sie nicht mehr die Heimat ist, bestatten. So müssen Möglichkeiten gefunden werden, die mit der angestammten Religion sowie den Gesetzen und Möglichkeiten der Schweiz im Einklang sind. Dabei gehen wir auf die 140000 Christlich-Orthodoxen, die aus vielen verschiedenen Ländern in die Schweiz gekommen sind, in diesem Artikel nicht ein.
Judentum
Die jüdische Bestattung findet in der Regel auf einem privaten Friedhof statt. Nach jüdischer Tradition gibt es nur die Erdbestattung mit der ewigen Grabesruhe. Dies hat zur Folge, dass der Platzbedarf sehr gross ist und heute immer noch sehr alte Friedhöfe erhalten sind. So gibt es zum Beispiel im Elsass, in Hegenheim, seit 1673 in idyllischer Lage einen jüdischen Friedhof. Dies ist zwar ein alter, aber nicht der älteste jüdische Friedhof in der Schweiz oder dem angrenzenden Ausland.[1]
Für alle Belange einer jüdischen Bestattung ist die «Chewra Kaddischa» besorgt. Es gibt je eine für die Frauen und die Männer. Sie sind so etwas wie Bestattungsbruder- oder -schwesternschaften, die alle Aufgaben, die mit dem Tod und der Bestattung verbunden sind, für die Angehörigen ehrenamtlich übernehmen. Die Chewra wird möglichst schon vor dem Ableben benachrichtigt. Sie sorgt für die Überführung zum Friedhof und die «Tahara» (Waschung)[2] sowie die anschliessende Einkleidung mit einem einfachen, weissen Totengewand und die Einsargung in einem Sarg aus einfachem unbearbeitetem Holz.[3] Der Tote soll nicht allein gelassen werden, die Wache soll möglichst Tag und Nacht erfolgen.[4] Die Bestattung sollte möglichst schnell erfolgen, aber nicht an einem Sabbat oder Festtag.[5] Die Feier findet auf dem jüdischen Friedhof statt. Direkt anschliessend wird der Sarg ins Grab überführt und von den männlichen Angehörigen mit Erde bedeckt.
Es ist eine uralte, bis zu den Erzvätern zurückgehende Sitte, dass Juden auf jedes Grab einen Grabstein setzen, zum Zeichen der Ehre und des Respekts für die Verstorbenen, sodass sie nicht vergessen werden und ihr Grab nicht entweiht werde.[6] Der hebräische Text auf dem Grabstein muss nach den religiösen Vorschriften geschrieben werden. Wie der Grabstein gestaltet wird, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und des Zeitgeistes. Das einzige Kriterium bei der Anlage eines Grabes ist die Erfordernis, es so zu gestalten, dass nicht über das Grab geschritten wird. Da die Gräber normalerweise in exakt ausgerichteten Reihen angelegt werden, ist dieses Erfordernis leicht zu erfüllen.
Die Gräber sollten wenn immer möglich in Richtung Jerusalem – bei uns also nach Osten – ausgerichtet werden. Über den Zeitpunkt der Grabsteinsetzung gehen die Meinungen auseinander. In Israel geschieht dies bereits nach 30 Tagen, im deutschsprachigen Raum meist erst nach einem Jahr.[7] Es ist üblich, bei einem Grabbesuch einen Kieselstein auf den Grabstein zu legen.
Da alle jüdischen Friedhöfe im Besitz der jüdischen Gemeinden sind, braucht sich die Öffentlichkeit kaum mit der Anlage zu beschäftigen.
Islam
Im Islam sind manche Vorschriften mit den jüdischen vergleichbar. Jeder Muslim hofft, nach dem Tod und dem Gericht über sein Leben im Jenseits, im Paradies bei Gott leben zu dürfen. Der Körper bleibt im Grab bis zur Auferstehung am Tag des Jüngsten Gerichts. Deshalb kennen Muslime auch die ewige Grabesruhe.
In Genf wurde in der Schweiz die erste richtige Moschee gebaut, und bereits 1978 konnten die dort ansässigen Muslime ihren eigenen Teil auf dem Friedhof Petit-Saconnex eröffnen. Bestattungen nach islamischem Ritus sind dort inzwischen eine Selbstverständlichkeit. In der Moschee besteht ein eigener Leichenraum mit Kühlfächern und einem Leichenwaschtisch. Zunächst blieb dies der einzige Muslimfriedhof der Schweiz. Erst im Jahr 2000 zogen Bern und Basel nach. Seither sind an mehreren Orten separate Grabfelder für Muslime realisiert worden, an anderen liegen entsprechende Bewilligungen oder Projekte vor.[8]
Die Bestattung von Muslimen bietet mannigfache Probleme: Die Leiche muss rituell gewaschen werden.[9] Die Bestattung sollte so rasch als möglich erfolgen. Die Leiche darf nur in ein Leichentuch eingewickelt werden und muss ohne Sarg der Erde übergeben werden. Die Ausrichtung des Grabes[10] und die Ausgestaltung[11] müssen stimmen. Das Grabfeld darf nur mit muslimischen Gräbern belegt sein. Die ewige Grabesruhe muss gewährleistet sein. Die Gräber dürfen nicht mehrfach belegt werden. Manche Muslime verlangen sogar, dass auf einem bestehenden Friedhof die Erde ausgewechselt werden muss, wenn vorher dort Nichtmuslime bestattet gewesen waren.
Dies sind Maximalforderungen, die kaum alle erfüllt werden können. Die Muslime erklären sich in der Regel zu Kompromissen bereit. So gibt es unterdessen «Fatwas» (Rechtsgutachten), aus welchen ersichtlich ist, dass die Aussage über die so genannte ewige Ruhefrist nicht zutrifft. Was bleibt, sind erfüllbare Forderungen: so die Waschanlage für die rituelle Leichenwaschung. In Spitälern ist es schwierig, aber auf einzelnen Friedhöfen gibt es das bereits. Da die Waschung mit fliessendem Wasser – vorzugsweise mit einem Schlauch – erfolgt, muss der Leichenwaschtisch oder Raum entsprechend ausgestattet sein.
Muslime benötigen ein eigenes Grabfeld, auf dem die Gräber so ausgerichtet sind, dass die Verstorbenen in einer speziellen Grabnische auf die rechte Seite gelegt, mit dem Gesicht in Richtung Mekka liegen. Es gibt keine Trauerfeier im üblichen Sinne, sondern nur ein spezielles Totengebet. Dieses kann am Grab oder in einer Trauerhalle erfolgen, wenn diese keine «islamisch unüblichen Symbole» enthält wie zum Beispiel ein Kreuz oder ein (religiöses) Bild. Dieser Forderung kommen grosse Friedhöfe nach, indem sie einen religionsneutralen Raum zur Verfügung stellen.
Eine übertrieben kostspielige Bepflanzung und Ausgestaltung der Grabstätten ist unerwünscht.[12] Die Realität sieht allerdings oft anders aus. So finden wir auf dem Grabfeld in Genf und auf dem Islamischen Friedhof in Berlin vom einfachsten Grab ohne jeden Schmuck und sogar ohne Grabstein die ganze Palette bis hin zum Grabmonument.
Hinduismus
Hinduismus ist ein Sammelname für 100 oder mehr unterschiedliche Religionen und Glaubensformen. Deshalb gibt es auch keine festgelegten, für alle Hindus gültigen Bestattungsregeln. Bei allen Unterschieden in den verschiedenen Ausprägungen des Hinduismus ist der gemeinsame Nenner der Glaube an die Wiedergeburt, die Überzeugung, dass der Mensch wie jedes Lebewesen nicht nur einmal lebt.
Hindus kennen nur die Kremation. Normalerweise wird diese auf einem offenen Feuer vollzogen. Da dies bei uns nicht möglich ist, akzeptieren Hindus die Kremation im Ofen. Hindus benötigen keinen Friedhof oder eine Grabstätte, da die Asche in einen heiligen Fluss in Indien gestreut wird, im Idealfall in den Ganges. Tamilische Hindus streuen die Asche in einen ins Meer führenden Fluss auf Sri Lanka oder direkt ins Meer.
Hindus benötigen für die Leichenwaschung einen Leichenwaschraum mit Ablauf am Boden und einen stabilen Stuhl, auf den die Leiche gesetzt wird. In einem Spital ist dies nur schwer realisierbar, deshalb sollten grössere Friedhöfe entsprechend ausgestattet werden. Für die Abdankung wird ein neutraler Raum benötigt mit einem freistehenden Tisch. Es könnte auch ein stabiler Tisch auf Rollen verwendet werden, so dass die Leiche vom Waschraum in die Halle überführt werden kann. Da die Trauergemeinde tiefer sitzen muss als der Verstorbene, dürfen keine festen Bänke im Saal sein. Das letzte Ritual wird im Kremationsraum vollzogen. Der älteste Sohn entzündet normalerweise das Feuer. Im Krematorium ersetzt der Druck auf den Knopf zum Einfahren der Leiche diese Handlung. Kleine Kinder bis zu etwa fünf Jahren werden nicht kremiert, sondern bestattet.
Buddhismus
Buddhisten glauben auch an eine Wiederkehr. Sie kennen ebenso wie Hindus nur die Kremation. Buddhisten benötigen keine Abdankungshalle und normalerweise auch keinen Friedhof. Sie verrichten das eher kleine Ritual vor der Kremation in der Kremationshalle. Die eigentliche Trauerfeier der tibetischen Buddhisten findet etwa eine Woche später mit der Urne im Kloster Rikon statt, diejenige der Thai-Buddhisten im Wat Srinagarindravaram in Gretzenbach. An der Aussenmauer des Wat Srinagarindravaram gibt es Urnennischen.
Weitere Religionen
Es gibt noch weitere Religionen in der Schweiz, wie zum Beispiel die Bahá’í, Sikh und Jaina. Die Bahá’í bestatten ihre Verstorbenen auf dem nächstliegenden Friedhof und haben diesbezüglich keine Sonderwünsche. Für die beiden indischen Religionen gibt es nur die Kremation.
Wo stehen wir heute?
Die Diskussion um die Integration von Immigranten ist in vollem Gange, das ist auch bei der Bestattungskultur spürbar. Glücklicherweise sind Behörden und Politiker mit den Angehörigen der Religionsgemeinschaften im Gespräch und suchen nach Lösungen für anstehende Probleme. Das Vordringlichste ist zurzeit, auf den Friedhöfen für die Muslime eigene Grabfelder einzurichten.
Trotz der vielen Kirchenaustritte herrscht auf unseren Friedhöfen immer noch eine christliche Dominanz. Neben den christlichen Kapellen müssen aber auch neutrale Abdankungshallen für andere Religionen errichtet werden. Muslime, Aleviten und Hindus benötigen zudem Leichenwaschgelegenheiten, die den Riten ihrer Religionen entsprechen.anthos, Sa., 2007.03.10
[1] Jüdische Friedhöfe in der Schweiz: http://www.alemannia-judaica.de/ schweiz_friedhoefe.htm
[2] Levinger I.M. Rabbiner Dr.: Der letzte Weg. Vorschriften, Gebete und Gedanken zum Thema «Tod und Trauer». Basel 1991, S.13
[3] Levinger, S. 16
[4] Levinger, S. 17
[5] Chajim Halevy Donin: Jüdisches Leben. Eine Einführung zum jüdischen Wandel in der modernen Welt. Zürich 1987–5747. S. 305
[6] Donin, S. 315
[7] Donin, S. 315
[8] Bekannt sind bisher: Basel, Bern, La Chaux-de-Fonds, Küsnacht ZH, Liestal, Lugano, Luzern, Olten, Zürich
[9] Guindi Mahmoud El/
Mansour Mohamed: Bestattungsregeln im Islam. Kairo o. J., S. 12–17
[10] Guindi/Mansour, S. 9
[11] Guindi/Mansour, S. 27–30
[12] ders.
10. März 2007 Christoph Peter Baumann
Trauer und Trost - Neue Gemeinschaftsgräber in Zürich
Wegen der grossen Nachfrage mussten in den vergangenen Jahren auf einigen der städtischen Friedhöfe Zürichs neue Gemeinschaftsgräber geschaffen werden. Es sind verschiedene, eigenständige Lösungen entstanden.
Im Auftrag von Grün Stadt Zürich konnte das Büro Berchtold Lenzin in den vergangenen Jahren drei neue Gemeinschaftsgräber auf städtischen Friedhöfen realisieren. Trotz ähnlicher Rahmenbedingungen und Anforderungen hat die Auseinandersetzung mit den spezifischen Orten zu sehr unterschiedlichen Lösungen geführt. Allen Projekten ist gemeinsam, dass sie aus dem Bestand heraus entwickelt wurden und sich auf die Stimmung der jeweiligen Friedhofsanlagen beziehen. Die Interpretation des Vorgefundenen regt in vielerlei Hinsicht an und überlagert sich mit eigenen Bildern und Vorstellungen. Oftmals gilt das Interesse dem Nebeneinander von Gegensätzen, den lauten und leisen Kontrasten, die sich gegenseitig stärken. Daraus entstanden eigenständige, vielschichtig lesbare Grabstätten – Räume mit der für das Trauern notwendigen Intimität, die Halt geben und aufnehmen sollen.
Friedhof Altstetten
Das neue Gemeinschaftsgrab nimmt die ursprüngliche Längsachse des alten Friedhofteils auf, die mit einer flachen Rampe als Eintritt und rückseitigem Treppenabgang zum Aussichtsplatz weiter fortgesetzt wird. Eine grosszügige Kiestreppe führt zur Rasenfläche, worin die Bestattungen vorgenommen werden. Locker in die Treppenanlage eingestreute Solitärsträucher bilden eine diffuse Raumgrenze, die sich im vorderen Bereich des Rasens auflöst. In die Kiestreppe eingelassen sind Natursteinplatten für Inschriften. Die Anordnung der Platten erinnert an eine Musikpartitur. Das warme Rot der Sandsteinplatten und das rostende Metall der Stufen stehen im Kontrast zum dunklen Kiesbelag und den angrenzenden Rasenflächen. Seitlich wird die Grabstätte durch bestehende, kastenartig geschnittene Hecken gefasst. Über diese hinweg führt der Blick zur einen Seite der Stadt, auf der anderen Seite zum Ausläufer des Uetlibergrückens. Als Hintergrund schliessen frei wachsende Buchsbäume die Bestattungsfläche ab.
Friedhof Fluntern
Der Standort des neuen Gemeinschaftsgrabes liegt abseits vom Hauptweg zwischen Waldrand und markanter Fichtenreihe auf abfallendem Gelände. Die stimmungsvolle Raumstruktur an peripherer Lage erfordert für die Auffindbarkeit ein Zeichen. Zwei versetzt angeordnete, ungleiche Stampflehmmauern spannen einen Aufenthaltsbereich am unteren Rand des Geländes auf. In Ihrer Materialisierung und Massigkeit stehen sie dezent und trotzdem gut erkennbar für die neue Grabstätte. Eine vom Kiesweg abgesetzte Bodenplatte führt an der Mauer vorbei in die Anlage. Der mit Trasskalk gebundene Bodenbelag nimmt die erdige Erscheinung des Lehms auf und endet an der längeren Mauerscheibe. Vor immergrünem Pflanzenhintergrund durchflirrt eine transparente Bronzestangenwand den Raum zwischen den Mauern. Auf den Bronzestäben können Namen eingraviert werden. Die gewählten Materialien bilden eine Einheit, die sich in den parkartigen Kontext einfügt und zugleich Bezug zum Ort nimmt: der Stampflehm als verdichteter Zustand von Erde, dem letzten Ruheort. Sowie in seiner kontinuierlichen Verwitterung als Metapher vom Dasein und der Vergänglichkeit. Oberhalb des Gedenkplatzes liegt die mit Buchsbaum und Schneeflockenstrauch eingefasste, ansteigende Bestattungsfläche. Der Blick streift darüber hinweg zum Waldrand hoch.
Friedhof Nordheim
Das seit Jahren bestehende Gemeinschaftsgrab wurde durch den Einbezug der angrenzenden, abgeräumten Grabfelder wesentlich vergrössert. Die Grabstätte besetzt neu die gesamte Lichtung, die von teilweise mächtigen Bäumen umsäumt ist. Am stärksten prägen zwei Eichen, die im unteren Teil ein Aussichtsfenster Richtung Oerlikon und Seebach bilden. Eine ergänzende Pflanzung mit Sträuchern konkretisiert den Rahmen des Pflanzenbestandes und bereichert ihn zur Blüte- und Herbstzeit. Ein Zickzackweg aus Beton führt in leichtem Gefälle durch die geneigte Rasenfläche. Darin werden die Beisetzungen vorgenommen. Bergseits wird der Weg von einem Natursteinband begleitet, worin die Namen der Verstorbenen eingraviert werden können. Durch das Weglassen von weiteren Gestaltungselementen wird der Weg zum Zeichen für das neue Gemeinschaftsgrab. Durch seine prägnante Form und den hellen Betonflächen tritt er in starken Kontrast zu den umgebenden Grünflächen. Je nach Standort hat der Weg eine ganz andere Präsenz: Von oben betrachtet scheint er beinahe die ganze Bodenfläche zu bedecken. Vom Hangfuss aus verliert er sich als feine, hin und her laufende Linie in der Grünfläche.anthos, Sa., 2007.03.10
10. März 2007 Roman Berchtold
Parco della Memoria, Mailand
Vor den Toren Mailands ist diese Lebenslandschaft nicht als Friedhof im ursprünglichen Sinne gedacht, sondern als Park, der als Ort des Erinnerns auch geistige Erholung bietet.
Ein Park als Ort des Erinnerns, um sich selbst wieder zu finden und am Seeufer auszuruhen. Ein Park mit Waldwegen und Blick auf das Bergmassiv des Monte Rosa in der Ferne. Ein Park für einen Moment der Einsamkeit und Reflexion oder für einen einfachen Spaziergang auf den zahlreichen Wegen und Pfaden, die sich durch das Grün winden.
Die Entdeckung des Parks
Jenseits des Haupteingangs mit seinem Tor als von der Strasse aus sichtbarem architektonischen Zeichen befinden sich auf beiden Seiten Parkplätze. Von diesem zentralen Punkt gehen zwei Wege aus: der den Park umfassende ringförmige Fahrweg, auf dem alle Bereiche der Anlage schnell und bequem zu erreichen sind und der es erlaubt, in unmittelbarer Nähe des Besuchsziels zu parken, sowie der Fussweg, Rückgrat und Leitmotiv für das landschaftliche Erleben des Parks, konzipiert als eine Sequenz von Themen.
Das Haupttor hinter sich lassend, geht man einer breiten, sanft ansteigenden Rampe entgegen, eine perspektivische Täuschung lässt sie tiefer erscheinen. Ein von hohen Bäumen flankierter Kiesweg führt weiter auf einen Aussichtspunkt zu. Von dieser Terrasse aus überschaut und geniesst man den Park als Ganzes: Zwischen den Hügeln liegt der See, Baumreihen und Baumhaine säumen sie, während in der Ferne über den Baumkronen das Massiv des Monte Rosa das Bild vollendet und der Park mit dem Horizont verschmilzt. Der Platz bietet die Möglichkeit zum Ausruhen, er ist Ort der Begegnung, ist Ausgangspunkt der Wege des Parks, ist aber auch Ort der Meditation.
Im Dialog miteinander stehend, liegt auf jeder Seite der Rampe jeweils ein besonderer Raum. Der erste ist ein Volumen, geschaffen durch die Gegenwart einer Kapelle, der zweite hingegen ist die Leere, ein Raum inmitten des Waldes, ein mysteriöser, dem Unbekannten gewidmeter Ort.
Die Kapelle
Am Rande einer Ebene von beträchtlichen Ausmassen, von einer waldähnlichen Vegetation umgeben, hat die Kappelle eine privilegierte Lage im Gesamtkontext. Dieses Fenster im Wald verleiht der Kappelle die nötige Entrücktheit, um sie zu einem Ort der Spiritualität zu machen.
L’Ignoto – das Unbekannte
Ein zweites Fenster im Wald, eine Wiesenlichtung, bildet das Peristyl eines geheimnisvollen Ortes. Mysteriös umschliesst dieser Ort einen starken Gedanken, die Idee des Verzichts auf das Erinnern in jeglicher Form, Erinnern ausschliesslich in Gedanken.
Der Park, die Topografie
Im Zentrum des Parks, wo man den Boden bis zum Grundwasser ausgehoben hat, befindet sich eine spiegelnde Wasserfläche, ein sich selbst überlassenes, sich frei entwickelndes Biotop, anspruchslos im Unterhalt. Dieser See liegt mindestens sieben Meter unterhalb des jetzigen Terrains. Der Höhenunterschied wird durch die aus dem Aushub aufgeschütteten Hügel ringsum noch verstärkt. Man wird also den Park auf dem jetzigen Niveau betreten, nach oben steigen, auf dieser Höhe den Blick über die Kuppeln der Hügel schweifen lassen, um dann hinunterzugehen in die kraterförmige, nur leicht betonte Talsenke, an den von Hügeln, Baumreihen, Wegen und Wäldern umgebenen See.
Die Grabfelder
Die Grabfelder liegen parallel zu den Höhenlinien der Topographie. Durch hohe Gräser entlang der Grabplatten werden diese vom Betrachter als grüne Felder wahrgenommen. Baumreihen ermöglichen Zurückgezogenheit für die Andacht und Ungestörtheit durch die den Park durchwandernden Besucher. Eine Gelegenheit, um Individualität vor Menschenmengen zu schützen.
Der «Percorso d’Arte»
In einem Waldstreifen, der sich über einen Kilometer durch die Felder mit den Gräbern zieht, stehen Kunstwerke, Skulpturen.
Vom ersten Grün zum gewachsenen Park
Während in einer ersten Phase vor allem schnell wachsende Pflanzen wie Pappeln, Eschen und Birken bevorzugt werden, dominieren in einer zweiten Phase eher hochwertige, langsam wachsende und langlebige Bäume: Eichen, Linden, Ulmen und Kastanien.
Zwischen den Grabfeldern, gleichsam um sie zu differenzieren, werden verstreut Obstbäume wachsen: Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen. Ihre verschiedenartige Blüte schafft ein immer anderes Ambiente, verleiht den einzelnen Grabfeldern ihre Individualität.
Das etappenweise Entstehen des Parks
Nach Erstellung der Eingangsbereiche mit ihrer Infrastruktur entwickelt sich der Park aus seinem Zentrum heraus in Richtung der Randbereiche. Auf diese Weise wird schon zu Beginn ein starker Anziehungspunkt geschaffen, der auch eine flexible Planung der Erweiterung ermöglicht.
Intention und Fazit
Der Mensch schafft eine Landschaft, er vereint sie mit dem Horizont und lässt sich in ihr nieder, um dort zu leben. Ein Ort, an dem man sich auch ausruht, lebt und meditiert, wo man sich trifft und wohin man wiederkommen möchte. Eine aus dem Bestehenden heraus neu geschaffene Landschaft mit starken Linien, klar und deutlich, die bei der Suche nach dem Wesentlichen das Überflüssige hinter sich lässt. Ein Ort, so stark, dass man ihn fühlt.anthos, Sa., 2007.03.10
10. März 2007 Paolo Bürgi
verknüpfte Bauwerke
Parco della Memoria, Mailand