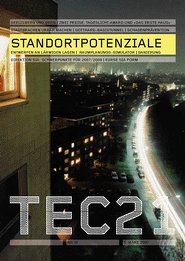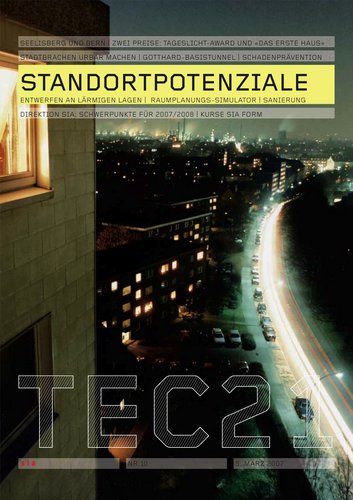Editorial
Schon lange wollte TEC21 ein Heft machen über Lärmschutz im Wohnungsbau. Immer wieder weisen uns Architektinnen und Architekten darauf hin, dass die Umsetzung der Lärmschutzverordnung in manchen Kantonen und Gemeinden das Planen von Wohnungen an gewissen Lagen schwierig oder gar unmöglich mache. Die Folgen seien Strassenzüge, die auf lange Zeit hinaus als Wohnraum aufgegeben würden, oder dann eine «Lärmriegel-Architektur», die sich von der Strasse abwende und mit unwirtlichen Betonmauern oder Glaswänden von der Umgebung abschliesse.
Bei der Recherche für dieses Heft wurde dann aber etwas anderes deutlich: Lärm kann erfinderisch machen! Die Voraussetzung dafür ist allerdings eine Bauherrschaft, die nicht nur die Hausbewohner vor dem Strassenlärm schützen will, sondern sich darüber hinaus auch um die Qualität des öffentlichen Aussenraums kümmert. Eine solche Bauherrin ist die Stadt Zürich. Da sie für ihre eigenen Wohnsiedlungen und für zahlreiche Wohnbaugenossenschaften Architekturwettbewerbe durchführt, hat sie viele Gelegenheiten, Innovation zu fördern. Einige exemplarische Projekte der letzten Jahre stellen wir vor. Bei allen hatte der Strassenlärm starken Einfluss auf die Form. Dabei wurde aber eine erstaunliche Vielfalt an Grundrissen und städtebaulichen Lösungen entwickelt. Simple «Lärmriegel-Architektur» hat hier ausgedient, und es zeigt sich, dass auch an schwierigen Lagen gute Architektur und guter Städtebau möglich sind. Das ist erfreulich, denn «Boulevards statt Verkehrs-
kanäle» muss die Losung heissen, wenn nicht ganze Schneisen in unseren Städten als Lebensraum aufgegeben werden sollen.
Dass manche vermeintlich schlechte Lage unterschätzt wird, das enthüllt – nebst anderen überraschenden Zusammenhängen – auch der kühle Blick eines so genannten hedonischen Modells: Das von Martin Geiger entwickelte, auf der Standort-, Nutzungs- und Landwerttheorie beruhende SNL-Simulationsmodell zeigt, ausgehend von real bezahlten Preisen, welche Standortmerkmale die Marktakteure in ihren Wohn- oder Investitionsentscheiden berücksichtigen und welche Marktdynamiken die Summe ihres Handelns auslöst. Mit dem Modell hat Geiger vor kurzem für das Bundesamt für Wohnungswesen den gesamten Schweizer Mietwohnungsmarkt untersucht. Dank Informationstechnologie und verbesserten statistischen Informationen, die heute in geokodierter Form vorliegen, kann es für die 2 Mio. bebaubaren Hektarstandorte in der Schweiz die effektiv vorhandenen Eigenschaften messen, den Wert in Fr./m2 evaluieren und die Veränderungen über die Zeit beobachten. Auch Wertsteigerungen oder -minderungen durch planerische Massnahmen lassen sich berechnen. Gemeinden, Planer und Investoren können damit simulieren, wie stark negative Standortfaktoren – beispielsweise Strassenlärm – den Wert einer Lage vermindern bzw. um wie viel ihn planerische Massnahmen – beispielsweise Verkehrsberuhigung oder Aussicht auf einen neuen Park – steigern könnten. Ruedi Weidmann
Inhalt
WETTBEWERBE
Neue Ausschreibungen / Zeitalter der Erleuchtung? / Nordisch leben im Dählhölzli / Ausgezeichnete Belichtung / Erstlingswerke
MAGAZIN
Stadtbrachen urbar machen / Gotthard-Basis¬tunnel / Verein für Bauschadenprävention / Leserbrief: «Beleidigt»
ENTWERFEN AN LÄRMIGEN LAGEN
Ursula Müller, Daniel Kurz
Neuere Wohnbauwettbewerbe in der Stadt Zürich zeigen, dass Lärmvorschriften nicht zu einer
introvertierten «Lärmschutzarchitektur» führen müssen.
EİN SİMULATOR FÜR DİE RAUMPLANUNG
Martin Geiger
Das SNL-Simulationsmodell berechnet kühl den Wert jedes Standorts und erkennt so verborgene raumplanerische Potenziale.
SANİERUNG BESTEHENDER BAUTEN
Urs Hess-Odoni
Die Normen für Neubauten lassen sich nicht einfach auf bestehende Bauten anwenden.
SIA
Direktion: Schwerpunkte des SIA für 2007/2008 / Kurse SIA Form
PRODUKTE
IMPRESSUM
VERANSTALTUNGEN
Entwerfen an lärmigen Lagen
Lärm belastet immer mehr Menschen im Wohnalltag. Zu deren Schutz setzen die eidgenössische Lärmschutzverordnung (LSV) und ihre Anwendung in den Kantonen Normen für den Wohnungsbau. Neuere Wohnbauwettbewerbe in der Stadt Zürich zeigen, dass diese Vorschriften nicht zu einer introvertierten «Lärmschutzarchitektur» führen müssen.
Lärm ist keine Nebensache. Allein in der Stadt Zürich wohnen und arbeiten 140 000 Personen, also mehr als ein Drittel der Stadtbevölkerung, an verkehrsreichen Strassen, wo die Lärmimmissionen die amtlichen Grenzwerte überschreiten. Für 20 000 Personen übertrifft der Lärm sogar die Alarmwerte (Tageswert 70 dB in Wohnzonen, vgl. Bild 1). Für die Betroffenen – sehr oft sozial benachteiligte Gruppen – kann dauernde Lärmbelastung gesundheitliche Folgen haben. Architektinnen und Architekten haben beim Bauen an lärmexponierten Lagen besondere Vorschriften zu beachten, die sich aus der eidgenössischen Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 ableiten. Für den Vollzug der Verordnung sind die Kantone zuständig, die je eine eigene Praxis entwickelt haben. Grosse Städte wie Zürich besitzen eigene Lärmschutzfachstellen, die die Baugesuche prüfen. Sie koordinieren ihre Praxis mit den kantonalen Stellen. Um die unübersichtliche Vollzugspraxis in der Schweiz etwas zu vereinheitlichen, hat der «Cercle Bruit», die Vereinigung der kantonalen Lärmschutzfachleute, die Absicht, einen Leitfaden für Architektinnen und Hausbesitzer herauszugeben.
Bauen an lärmigen Strassen
Lärmgrenzwerte sind keine absoluten Grössen, sondern abhängig von der Dauer und vom Zeitpunkt (Tages- und Nachtwerte) und von nutzungsabhängigen Empfindlichkeitsstufen. In der Stadt Zürich zum Beispiel gehören Zonen mit einem Wohnanteil von mindestens 90 % zur Empfindlichkeitsstufe II mit dem Tagesgrenzwert von 60 dB(A), was etwa dem Lärm von 100 Autos pro Stunde entspricht.
Die LSV will primär das Entstehen von Lärm an der Quelle verhindern und befasst sich nur am Rand mit dem Problem des Bauens an lärmbelasteten Standorten. Als einzige für alle Kantone verbindliche Vorgabe verlangt sie in Art. 31 die «Anordnung der lärmempfindlichen Räume auf der dem Lärm abgewandten Seite des Gebäudes». Diese absolute Forderung birgt jedoch die Gefahr in sich, dass sich Neubauten an belasteten Strassen vollständig vom öffentlichen Raum abwenden und diesen ganz dem lärmverursachenden Verkehr überlassen. Der daraus folgende Verlust an sozialem Leben und sozialer Kontrolle könnte für Sicherheit und Lebensqualität an solchen Strassen gravierende Folgen haben.
Um diese Gefahr zu vermindern, räumt der Kanton Zürich seit langem die Möglichkeit ein, dass Wohnräume auch auf der lärmigen Seite liegen dürfen, wenn sie auf der ruhigen Seite ein zusätzliches «Lüftungsfenster» aufweisen. Das kann mit Wohnräumen erreicht werden, die von Fassade zu Fassade durchgehen. Die Lärmschutzfachstelle der Stadt Zürich prüft jedes Jahr rund 1000 Baugesuche und ist bemüht, gute und innovative bauliche Lösungen zu ermöglichen. Daraus ergibt sich eine ständige Verfeinerung und Differenzierung der Bewilligungspraxis, die zwischen Stadt und Kanton koordiniert wird. Die Folge können willkommene Lockerungen sein: So galt für durchgehende Wohnräume noch vor kurzer Zeit die Faustregel, dass ihre Breite mindestens ein Drittel der Länge ausmachen müsse. Inzwischen wurde das Verhältnis auf 1:5 gelockert, was den Einsatz dieser Grundrissvariante wesentlich erleichtert.
Bei den meisten Wohnungsbau-Wettbewerben der letzten Jahre, die das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich organisierte, war der Umgang mit Strassenlärm eine massgebliche Rahmenbedingung im Entwurfsprozess. Meist galt es, Ersatzneubauten auf grösseren Parzellen an lärmbelasteten Lagen für gemeinnützige Bauträger zu planen. Neben der Frage nach dem adäquaten städtebaulichen Massstab im Fall von Verdichtung und Mehrausnützung und der Auseinandersetzung mit der preiswerten Familienwohnung für die nächste Generation galt es, neue Entwurfsregeln an lärmexponierten Strassen zu finden. Diese beeinflussten städtebauliche Haltungen, mögliche Gebäudetypologien und ihre architektonische Umsetzung bis hin zur Bestimmung des Raumprogramms. Die Überlagerung der Entwurfsanforderungen wurde von den Projektierenden immer wieder gemeistert ohne offensichtliche «Lärmschutzarchitektur» oder soziale Abkehr von der Strasse. Jedoch zeigt sich vor allem bei der Wohnungstypologie auch aufgrund der kantonalen Anwendungspraxis der eidgenössischen Lärmschutzverordnung eine Vereinheitlichung: das «Durchwohnen» mit einer seitlichen, zellulären Struktur zur ruhigen Seite. Die im Folgenden herausgepickten Beispiele der letzten Jahre machen bewusst, dass bei grossen Grundstücken vorab der städtebauliche und typologische Spielraum ausgeschöpft wird, bei kleinen Parzellen mit wenig Gebäudeabwicklung fast nur noch mit Anpassungen im Raumprogramm bzw. im Bewohnersegment reagiert werden kann.
Anpassung des Raumprogramms
Beim Ersatzneubau an der Langstrasse 200 für die Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich waren drei Rahmenbedingungen der Parzelle relevant für den Umgang mit der Lärmproblematik: die Langstrasse als lebendigste Ausgehmeile Zürichs, die Lage an der Nordecke einer Blockrandbebauung und die überschrittenen Lärmgrenzwerte an Langstrasse und Neugasse. Sie veranlassten die Bauherrin, das Raumprogramm bewusst minimal zu beschreiben: Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner sollten auf das städtische Leben ausgerichtete Menschen sein, die sich durch die spezielle Lage und Architektur angesprochen fühlen und beim Wort Wohnung nicht an funktionale Einheiten wie Schlaf- und Wohnzimmer denken. Die hohe Lärmbelastung lässt nur Wohnräume zu, die über die knappe Hofabwicklung belüftbar sind. Unter den über hundert eingegangenen Entwürfen des offenen Projektwettbewerbs fanden sich nur wenige geschickt zonierte Einraumwohnungen, die das Problem lösten. Der Architektin Zita Cotti gelang es am eindrücklichsten mit einer wohltuend zurückhaltenden Volumetrie und einer überraschend einfachen, räumlich jedoch vielfältigen Grundrissfigur (Bild 2).
Städtebauliche Reaktion
Das Projekt für einen Ersatzneubau der Siedlung Triemli für die Baugenossenschaft Sonnengarten aus dem Büro von Ballmoos Krucker Architekten reagiert auf die komplexe Lärmsituation mit einer städtebaulichen Antwort (Bilder 3–4). Die offene Grossform mit zwei mehrfach geknickten und verzogenen Gebäudezeilen, die von den Strassen leicht zurückgerückt sind, umfasst einen zentralen lärmgeschützten Hofraum als klaren Bezugspunkt der Genossenschaftssiedlung. Der etwas weniger lauten Triemlistrasse ist die strengere Empfindlichkeitsstufe II zugeordnet, was zu einer grösseren Grenzwertüberschreitung führt und somit nur ein lärmabgewandtes Lüften zulässt. Die etwas lärmintensivere Birmensdorferstrasse wird durch eine weniger strenge Empfindlichkeitsstufe IIIa (lärmvorbelastetes Gebiet) begleitet, hier lassen die mässig grossen Grenzwertüberschreitungen mehr Spielraum für den Grundriss. Die Verfasser reagieren mit zwei unterschiedlich tiefen Baukörpern und etwas grösseren Raumhöhen: an der Triemlistrasse mit einer schlankeren Gebäudetiefe und durchgehenden Wohn-Essbereichen, die zum Hof gelüftet werden, und entlang der Birmensdorferstrasse mit einem tieferen, zweiseitig ausgerichteten Gebäudetyp. Hier können die Schlafzimmer mit seitlicher Loggia zur Strasse orientiert sein, da die Lärmumlenkung um 90° des Lüftungsflügels zur Loggia die nötige Lärmreduktion bewirkt.
Im Wettbewerb für die Siedlung Grünwald der drei Bauträger Baugenossenschaft Sonnengarten, Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich und Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich im Quartier Rütihof wurden städtebaulich sehr unterschiedliche Vorschläge eingereicht. Für das Gelände im stumpfen Winkel zweier lauter Strassen schlugen Bünzli & Courvoisier / Fröhlich & Hsu Architekten / Esch Architekten strahlenförmig angeordnete Gebäudezeilen vor. Sie verbinden die Ausrichtung zum Sonnenlicht mit der Einfügung in die Hanglage. Gemäss der abnehmenden Lärmbelastung ins Parzelleninnere werden verschiedene Wohntypologien kombiniert. An den lärmbelasteten Enden finden sich in ihrer vielfältigen Lichtstimmung und räumlichen Spannung interessante, bis 24 m tiefe Maisonettewohnungen mit Lichthöfen (Bild 5).
Urs Primas / Franziska Schneider/Jens Studer hingegen schlagen eine Grossform vor, die einen weiten, ruhigen Landschaftsraum umschliesst. Sie setzt eine eindeutige Innen-Aussen-Ordnung und steht im Kontrast zu verschiedenen Bebauungsmustern mit offenen Freiraumkonzepten im Quartier. Entlang der lauten Strassen ermöglichen schlanke Gebäudetiefen das Belüften der Wohnung gegen den Binnenraum. Selbst die Ausbildung der Balkone ist der jeweiligen Lärmintensität angepasst (Bilder 6 und 7).
Architektonische Reaktion
Beim Ersatzneubau der Siedlung Brunnenhof für die Stiftung für kinderreiche Familien zwangen die schmale Parzelle entlang der Hofwiesenstrasse und die massiv überschrittenen Lärmgrenzwerte die Entwerfenden dazu, sich architektonisch und typologisch mit dem Bezug der Wohnung zur Strasse und mit der Wirkung der Gebäude auf die Strassenbenützer zu befassen. Der Entwurf von Atelier 5 reagiert mit einer vollflächigen Schallschutzglaswand mit Laubengang-Erschliessung als eigenständigem Gebäudeteil entlang der Strasse (Bild 8). Dahinter liegt, durch knappe Lichthöfe abgekoppelt, der klassisch entwickelte, zweiseitig ausgerichtete Wohnungsbau. Dieses voll verglaste Hochregal wirkt für den Strassenraum eher monoton und anonym. Das abgerückte Wohnen verstärkt auf der Hofwiesenstrasse den Eindruck eines Verkehrskanals.
Der Entwurf von Enzmann Fischer Architekten belebt die Strassenseite mit zweigeschossigen, grosszügigen Wohnküchen (Bild 09). Dieser Schwerpunkt der Wohnung bringt viel Tageslicht in die tiefen Baukörper und über die grossen Fenster gleichzeitig Leben auf die Strasse. Die übrigen Wohn- und Schlafräume sind zum Park orientiert. Bei dem im Bau stehenden Projekt von Gigon / Guyer gelingt es, durch eine geschickte Grundrissaufteilung beide Gebäudeseiten bedeutend zu gewichten (Bilder 10 und 11). Die Schlafzimmer sind zum Park orientiert, entlang der Strasse erlebt man eine Enfilade vom Treppenraum über die Eingangsloggia zur Essküche und bis zum Wohnzimmer, das die ganze Gebäudetiefe einnimmt. Der Strassenraum wird nicht durch Nebenräume degradiert.
Die Beispiele zeigen: Lärmbelastung und Lärmschutzvorschriften führen nicht automatisch zu einer Verengung der städtebaulichen Lösungsmöglichkeiten und nicht zwingend zu Lärmschutzarchitektur auf Kosten der Strasse als Lebensraum. Eine vertiefte Auseinandersetzung der Projektierenden mit der Problematik und innovatives Denken sind aber Voraussetzung für erfolgreiche Ansätze. Eine Schwierigkeit für die Jury-Arbeit ergibt sich jedoch immer wieder aus einer gewissen Rechtsunsicherheit bezüglich der Bewilligungsfähigkeit mancher Projektvorschläge.TEC21, Mo., 2007.03.12
12. März 2007 Ursula Müller, Daniel Kurz
Ein Simulator für die Raumplanung
Je mehr Land überbaut wird, umso brisanter wird die Raumplanung. Der Fall Galmiz hat deutlich gemacht: Eine Raumplanung, die nur das Resultat der politischen Aushandlung von Regionalinteressen kartografiert, genügt weniger denn je. Künftig sind konkrete Vorschläge für die nachhaltige Raumnutzung gefragt. Nützlich wäre dafür eine von Partikularinteressen möglichst unabhängige methodische Basis. Das im Folgenden vorgestellte Simulationsmodell berechnet kühl den Wert jedes Standorts und erkennt so verborgene Potenziale.
Sagt die Raumplanung nur, was wo zu bauen erlaubt ist, oder bedeutet die Festlegung auch, dass das betreffende Gebiet oder der betreffende Standort für die zugeordnete Nutzung geeignet, vielleicht sogar am besten geeignet ist? Sollte also die Raumplanung die verschiedenen Qualitäten eines Standortes für die verschiedenen heutigen und eventuell künftigen Nutzungen kennen? Hätte die Raumplanung beispielsweise im Fall Galmiz im Grossen Moos nicht schon lange vorher wissen müssen, dass einmal ein potenter Standortsuchender daherkommen und die Diskrepanz zwischen Planung und Realität mit einem einzigen Satz aufdecken wird: Warum wird dieser Standort so auffallend stark mit nicht weniger als vier Universitätsstädten (Bern, Freiburg, Neuenburg und Lausanne) und darüber hinaus mit der halben Schweiz vernetzt, wenn es doch so wichtig ist, dass die Idylle des Gemüsegartens nicht gestört wird? Das passt doch nicht zusammen!
Es gibt durchaus Planer, die argumentieren: Wir haben den politischen Auftrag, die Pläne in verschiedenen Farben anzumalen, ob die diversen Nachfrager dann etwas damit anfangen können, geht uns nichts an. Andere aber (und mit ihnen der Autor) sind der Meinung, dass die Raumplanung verpflichtet ist, zu beweisen, dass ihre Vorschriften zu einer Verbesserung der räumlichen Entwicklung führen werden. Das scheint auf den ersten Blick eine überrissene Forderung zu sein. Fragen wir jedoch umgekehrt: «Dürfen planerische Massnahmen auch zu einer Verschlechterung führen?», dann wird sofort klar, was gemeint ist.
Eine Probewirklichkeit für den Raumplaner
Wie kann man aber wissen, welche heutigen Ursachen morgen welche Wirkungen haben werden? Dazu braucht es ein von Politik und Wirtschaft unabhängiges Instrument, ein mathematisches Simulationsmodell, in welchem der gesamte Ursache/Wirkung-Mechanismus der Siedlungsentwicklung beobachtet werden kann. Erst aufgrund dieser Anschauung kann eine vernünftige parlamentarische Diskussion und Beschlussfassung stattfinden.
Das auf der Standort-, Nutzungs- und Landwerttheorie (SNL) beruhende Simulationsmodell ist ein solches Instrument. Dieses Modell betrachtet den Raum nicht als Ansammlung von politischen Gemeinden, sondern als einen neutralen Raster gleich grosser Standorte und erbringt folgende Leistungen:
1. Messung der effektiv vorhandenen Eigenschaften aller bebaubaren Standorte der Schweiz (20000 Quadratkilometer-Standorte für den Überblick oder 2 Mio. Hektar-Standorte im Detail) sowie Beobachtung der Veränderungen über die Zeit.
2. Periodische Analyse der Anforderungen der verschiedenen Nutzer (Betriebe, Wohnbevölkerung usw.) und flächendeckende Suche nach Standorten, die diese Anforderungen erfüllen.
3. Simulation der Konkurrenz der Nutzer um die besten Standorte sowie Prognose der in nächster Zeit zu erwartenden Veränderungen im Besiedelungsmuster der Schweiz.
4. Berechnung des Wertes der Standorte (in Fr./m2 oder Mietzins/Monat).
5. Berechnung der Auswirkungen und des Wertes planerischer Massnahmen.
Die zentrale Variable in diesen Berechnungen ist die so genannte Standortgüte. Es sind die räumlichen und zeitlichen Unterschiede der Standortgüte, die das Schauspiel der räumlichen Entwicklung inszenieren. Von Standorten mit niedriger oder sinkender Standortgüte ziehen Betriebe und Wohnbevölkerung weg, hin auf Standorte mit hoher oder steigender Standortgüte – und zahlen entsprechend dafür. Auf das reale Geschehen im Raum kann nur Einfluss nehmen, wer die Standortgüte erstens kennt und zweitens ihre Eigenschaften tatsächlich gezielt verändert. Die Wirkung von «Du sollst»- und «Du sollst nicht»-Geboten allein ist, wie die vierzigjährige Beobachtung der räumlichen Entwicklung gezeigt hat, bescheiden.
Die Standortgüte
Die Standortgüte ist im Detail hochkomplex, im Prinzip aber doch einfach zu verstehen. Wir umgehen hier eine Einführung in die SNL-Theorie, indem wir diese Aufgabe kurzerhand dem obersten Raumplaner der Schweiz, Bundesrat Moritz Leuenberger, zuschieben, der seinerseits Kurt Tucholsky zitiert, der mit spielerischer Leichtigkeit auf drei Zeilen alles klar macht:
«Ja, das möchtste:
Eine Villa im Grünen mit grosser Terrasse,
vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstrasse.» [1]
Auf hiesige Verhältnisse übertragen, heisst das: Villa im Grünen mit grosser Terrasse; vorne den Zürichsee und hinten die Zürcher Bahnhofstrasse. Damit ist die SNL-Theorie auf die kürzeste Formel gebracht. Die Bilder «Friedrichstrasse» oder «Bahnhofstrasse» illustrieren den wissenschaftlichen Begriff Beziehungspotenzial aus der SNL-Theorie (Beziehungspotenzial = Erreichbare Arbeitsplätze geteilt durch den dazu nötigen Transportaufwand). Die Bilder «Ostsee» oder «Zürichsee» illustrieren den wissenschaftlichen Begriff Umweltbedingter Eigenwert aus der SNL-Theorie (Umweltbedingter Eigenwert = Summe der angenehmen und der störenden Umwelteinflüsse). Beziehungspotenzial und umweltbedingter Eigenwert zusammen bilden schliesslich die Standortgüte. Die SNL-Theorie macht also die vom Dichter so anschaulich beschriebenen Anforderungen des Nutzers an die Eigenschaften des Raumes quantifizierbar.
Das Beziehungspotenzial
Für die Ansiedlung von Betrieben ist hauptsächlich die Standortgütekomponente «Beziehungspotenzial»[2] ausschlaggebend. Bestehende Siedlungen strahlen entlang von Transportachsen (mit der Distanz abnehmend) so genanntes Beziehungspotenzial aus. Das Beziehungspotenzial generiert von einem bestimmten Wert an einen Bauimpuls für neue Siedlungen – anfänglich in der Nähe der ursprünglichen Siedlungen, dann aber auch an Kreuzungen von Transportachsen. Dort können auch von weit entfernten Siedlungen her Bauimpulse im bisherigen Niemandsland generiert werden, also zum Beispiel auch im Grossen Moos oder andern Standorten, an die noch nie jemand gedacht hat (Bild 1).
Eine Illustration der Macht des Beziehungspotenzials liefert unter anderem die Entwicklung von Zürich in den vergangenen Jahrzehnten (Bild 2). Die Stadt wollte ursprünglich von der Autobahn profitieren, indem sie sie in Form eines Y ins Zentrum führte. Später befürchtete man einen Verkehrsinfarkt und erfand, um so etwas zu vermeiden, den Autobahn-Ring. Da aber ein Ring sich nicht in einer Nacht bauen lässt, musste man irgendwo anfangen. Warum nicht im Norden zwischen Zürich und Flughafen? Kaum aber war das erste Stück realisiert, wurde der Traum vom Ring (der seine Wirkung definitionsgemäss erst mit dem Einsetzen des letzten Pflastersteins entfalten kann) zerstört. Die Nordumfahrung kreuzt die Nord-Süd-Achse. Hier entsteht automatisch das neue «Verkehrszentrum» der Schweiz, von dem aus man die Wahl hat, die Westschweiz, die Ostschweiz, den Flughafen (im Norden) oder auch die Stadt Zürich (im Süden) zu erreichen. Das sich hier auftürmende Beziehungspotenzial hat gewaltige Auswirkungen. Statt dass das Stadtzentrum Zürich gestärkt würde, wächst hier das «zweite Zürich», gebildet aus Zürich Nord und der im Entstehen begriffenen Glatttalstadt. Niemand hat das explizit so gewollt. Tatsächlich sind solche Kettenreaktionen nur in einem Simulationsmodell vorhersehbar [3] (Bild 3).
Der umweltbedingte Eigenwert
Das Beziehungspotenzial bestimmt weitgehend auch die Standortwahl der Wohnbevölkerung.
Zusätzlich spielt hier aber auch der umweltbedingte Eigenwert [4] eine entscheidende Rolle. Es ist offensichtlich, dass Standorte mit hohem Beziehungspotenzial (definitionsgemäss verbunden mit Verkehr und Dichte) tendenziell negative (störende) Umwelteinflüsse produzieren, während umgekehrt Ruhe und Aussicht hohe Beziehungspotenziale eher ausschliessen. Die beiden Faktoren der Standortgüte (Beziehungspotenzial und umweltbedingter Eigenwert) sind also Gegenspieler im Wettbewerb um die Gunst der standortsuchenden Wohnbevölkerung.
Dies bestätigt die Karte (Bild 4): Auf den blauen Standorten befinden sich Haushalte, die auf ein hohes Beziehungspotenzial Wert legen (viele Möglichkeiten der Arbeit, des Einkaufs, der Bildung, der Unterhaltung und der sozialen Kontakte) und einen entsprechenden Mietzins dafür zu zahlen bereit sind. Auf den gelben Standorten befinden sich Haushalte, die Wert auf einen besonders
guten umweltbedingten Eigenwert (hier repräsentiert durch Seesicht) legen und einen entsprechenden Mietzins dafür zu zahlen bereit sind. Die beiden Präferenzgruppen bilden mehrheitlich eigenständige Muster im Raum. In drei städtischen Regionen aber überlagern sich die gelben und blauen Gebiete zu roten Gebieten, in denen der von Tucholsky formulierte Wohnwunsch wahr wird, also gleichzeitig ein hohes Beziehungspotenzial und einen exzellenten umweltbedingten Eigenwert zu geniessen. Die hier bezahlten hohen Mietzinse entsprechen berechenbar diesem Genuss.[5]
Wohnen statt Büros
Bis noch in die 1970er-Jahre diktierte praktisch nur eine Standortgüteeigenschaft die Entwicklung in den Städten: das Beziehungspotenzial. Da Büros und Geschäfte für hohe Beziehungspotenziale mehr bezahlen als Wohnungssuchende, wurden mit jedem Wachstumsschritt gnadenlos Wohnungen in Büros verwandelt und die Bevölkerung aufs Land vertrieben. Die Umwelt in der Stadt wurde nicht als eigenständige Kraft wahrgenommen. Die Verkehrslawine, die Spritzen im Park, das Badeverbot im See, das alles wurde mit dem Begriff Stadt gleichgesetzt.
Unterdessen haben zwei Entwicklungen stattgefunden, welche die Werte-Waage der städtischen Standorte zugunsten der Wohnbevölkerung beeinflussen: Erstens hat sich im ganzen Land und insbesondere in den Städten infolge der grossen Anstrengungen der öffentlichen Hand der umweltbedingte Eigenwert verbessert. In den Seen und Flüssen kann gebadet werden, viele emittierende Industrien sind weggezogen oder verschwunden, zahlreiche Schiessplätze und Flugplätze sind aufgehoben, neue Pärke und Alleen angelegt worden usw. Gleichzeitig haben sich aber auch die Anforderungen der Wohnbevölkerung an die Standorte gewandelt. Wie im jüngsten Forschungsbericht des Autors6 ausführlich beschrieben, werden auch in der Stadt positive umweltbedingte Eigenwerte explizit verlangt. Dabei ist die «Seesicht» (als Sammelbegriff für See-, Fluss- und Bergsicht) zur begehrtesten Standorteigenschaft avanciert. Für sie wird besonders viel zusätzlicher Mietzins bezahlt. So kann neuerdings Wohnnutzung auch auf Standorten mit starken Beziehungspotenzialen eine höhere Rendite abwerfen als Büronutzung. Dann nämlich, wenn der Standort einen positiven umweltbedingten Eigenwert aufweist oder ihm ein solcher gegeben wird (Bild 5).
Es kann sich für den Investor also lohnen, eine Seesicht selbst zu erschaffen, indem er beispielsweise in einem Teil des Baulandes aufs Bauen verzichtet und das geopferte Bauland unter Wasser setzt (Bild 6). Dann kann dieser künstliche See (unter Umständen) auf dem übrigen Teil des Areals den umweltbedingten Eigenwert und damit die Standortgüte für die Nutzung Wohnen derart erhöhen, dass, über alles gerechnet, eine höhere Gesamtrendite erzielt wird als bei der üblichen Maximalausnützung.
Zu grossflächigen Nutzungswechseln kann es heutzutage auch ganz ohne Opfer des Investors kommen. Dann nämlich, wenn das erhöhte Interesse der Wohnungssuchenden an positiven umweltbedingten Eigenwerten so sehr zunimmt, dass «verschüttete» (latent, aber ständig vorhandenen) Eigenwerte wiederentdeckt und die seinerzeit zweckentfremdeten Wohnliegenschaften wieder dem ursprünglichen Zweck zugeführt werden – nicht aufgrund eines gesetzlichen Zwangs, sondern im Bestreben der Investoren, den Wert zu maximieren.
Praktische Anwendung
So könnten wir fortfahren und eine Sammlung «Neue Planungs- und Bauregeln» anlegen. Während seiner Arbeiten im Zusammenhang mit der Revision des Mietrechts hat der Autor von Juristen tatsächlich öfter die Meinung gehört, er brauche doch sein Modell nur ein einziges Mal laufen zu lassen. Dann könnte eine abschliessende Liste der wertvermehrenden und wertvermindernden Standorteigenschaften und Planungsmassnahmen erstellt und in allen Amtsstuben aufgehängt werden. Wer so argumentiert, denkt statisch und unrealistisch. Der Simulator ist das genaue Gegenstück zu den planerischen oder juristischen in Stein gemeisselten Geboten. Dieses Instrument hat keine Ideologie und predigt keine Verhaltensregeln. Dafür läuft es permanent und setzt jedes Phänomen sogleich in Relation zu andern Phänomenen. Der Simulator macht (genau wie jener des Piloten, des Chirurgen, des Erdbebenforschers) auf Zusammenhänge aufmerksam, die von blossem Auge nicht erkennbar sind.
Dabei tritt auch die ausgeprägte Relativität des Wertes baulicher Massnahmen zutage. Das einleuchtendste Beispiel dafür liefert die bekannte «Balkonfrage»: Ein Vermieter hängt zwecks Verbesserung der Rendite einen Balkon an sein Mietshaus, wo bisher keiner war. Was kann er dem Vermieter verrechnen? Die häufigste Antwort ist die juristische: so viel, wie zur Verzinsung der Baukosten nötig ist. In Wirklichkeit aber bestimmt nicht der Balkon an sich (also auch nicht seine Erstellungskosten) den Wert der Aktion, sondern der Standort des Mietshauses: Steht das Haus unter der Autobahn, zahlt der Mieter gar nichts, steht es aber an einem Südhang und überblickt See und Berge, so ist der Mieter bereit, für den durch den Balkon ermöglichten Mehrgenuss entsprechend mehr zu bezahlen.
Auch der Wert von planerischen Massnahmen ist relativ und nicht so ohne weiteres von blossem Auge zu erkennen. Der Wert eines künstlichen Sees oder eines Stücks Autobahn beispielsweise manifestiert sich erst durch das, was damit ausgelöst wird. Stellt man neben den künstlichen See eine Fabrik, so geschieht gar nichts. Ist aber das neue Stück Autobahn der Missing Link, der das gesamte Transportnetz zum Funktionieren bringt, so steht bereits am nächsten Tag der clevere Investor da.
Der Vorteil der Anwendung eines Simulationsmodells in der politischen Planungspraxis ist klar: Im politisch neutralen Modell kann frühzeitig erkannt werden, wo sich für die räumliche Entwicklung Chancen auftun oder Probleme zusammenbrauen. Darauf können die Planer reagieren, indem sie selbst in die vom Computermodell simulierte Realität einsteigen und in ihr im Voraus Ideen und Vorschläge so lange testen, bis ihre Auswirkungen erkannt und ihr Nutzen quantifiziert, sichtbar und plausibel ist – und zwar für alle Beteiligten: für die Planer selbst, für die standortsuchenden Nutzer, für die Anlagemöglichkeiten suchenden Investoren und für die Entscheidungshilfen suchenden Politiker.TEC21, Mo., 2007.03.12
Anmerkungen
[1] Kurt Tucholsky: Auf dem Land wohnen, zitiert von Moritz Leuenberger in der Rede zum 25-Jahr-Jubiläum des Raumplanungsgesetzes. 2004.
[2] Martin Geiger: Die Standortgüte in städtischen Regionen. Das Beziehungspotenzial als ausschlaggebende Variable bei der Standortwahl des Industrie-, Dienstleistungs- und Wohnsektors in der Region Zürich. Diss. ETH Zürich. 1973.
[3] Siehe dazu auch: Martin Geiger: Form follows function im Städtebau. Werk, Bauen und Wohnen. November 1999.
[4] Siehe dazu u.a.: Martin Geiger: Wohnung, Wohnstandort und Mietzins. Band 33 Schriftenreihe Wohnungswesen. 1985.
[5] Ausführlich beschrieben in Martin Geiger: Der Mietwohnungsmarkt. Analyse von Ursache und Wirkung im grössten Markt der Schweiz. Band 77 Schriftenreihe Wohnungswesen. 2006.
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen. Nr. 725.077.
[6] Ebd.
12. März 2007 Martin Geiger