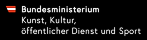artikel - event
Veranstaltung
Hans-Walter Müller: Ich habe die Schwerkraft schon verlassen
Ausstellung
Fr., 2022.03.04 bis Sa., 2022.06.18
aut. architektur und tirol
Lois Welzenbacher Platz 1
A-6020 Innsbruck
Lois Welzenbacher Platz 1
A-6020 Innsbruck
Eröffnung: Do., 2022.03.03, 14:00 Uhr
Anstelle einer Ausstellungseröffnung findet zwischen 14.00 und 20.00 Uhr ein Soft-Opening statt, bei dem Hans-Walter Müller anwesend sein wird.
Teilnahmebedingungen: 2G-Nachweis, FFP2-Maske
„Warum aufblasbare Strukturen? Weil sie uns in eine andere Welt entführen, uns zum Nachdenken anregen, uns vergessen lassen, was wir in der Schule gelernt haben. Damit wir wieder wir selbst werden können.“
(Hans-Walter Müller, 1975)
Der Architekt, Ingenieur und Künstler Hans-Walter Müller hat die aufblasbare Architektur zwar nicht erfunden, er hat ihr aber fast sein ganzes Leben verschrieben und dabei ein unglaubliches Œuvre geschaffen. Seit über 50 Jahren setzt er sich mit einwandigen pneumatischen Strukturen auseinander und realisiert Tragluftvolumen für so unterschiedliche Nutzungen wie Ausstellungen, Festivals, Theater- und Konzertaufführungen, aber auch für ein temporäres Einkaufszentrum oder eine zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge.
1935 in Worms geboren, studierte er an der Technischen Hochschule in Darmstadt und ab 1961 an der École des Beaux-Arts in Paris. Hier fand der Visionär und leidenschaftliche Zauberer in der Bewegung der kinetischen Kunst seine künstlerische Heimat. Ausgehend von Experimenten mit Diaprojektionen erfand er 1963 mit der „Genèse 63“ seine erste kinetische Maschine für motorenbetriebene Licht- und Bild-Projektionen, die er 1965 zur „Maschine M“ weiterentwickelte. Lotete er mit dieser vorerst das Potenzial aus, bewegte Bilder auf statische Flächen zu projizieren, so interessierte er sich ab Mitte der 1960er Jahre zunehmend dafür, wie die Architektur selbst bewegt gemacht werden kann. Im Rahmen der Ausstellung „Structures Gonflables“ im Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris, die sich 1968 ganz diesem Thema widmete, stellte er mit „Imaginaire Volux“ erstmals eine Kombination seiner Projektionen mit einem eigens dafür entwickelten Kunststoffvolumen aus. Die Luftzufuhr war so programmiert, dass das Volumen immer wieder zusammensackte und sich danach wieder aufbaute – ein Raum in atmender Bewegung.
Ab diesem Zeitpunkt widmete sich Hans-Walter Müller fast ausschließlich dem Thema der von Luft getragenen Architektur und entwickelte Volumen in immer größeren Dimensionen. Mit einer nicht einmal 40 kg schweren aufblasbaren Kirche erzielte er 1969 erstmals überregionale Bekanntheit. Es folgten erste Aufträge aus der Kunst- und Theaterszene, später auch von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. 1970 produzierte er mit einer Hochfrequenzschweißmaschine ein Volumen über sechseckigem Grundriss in drei Farb- bzw. Materialversionen, die er an unterschied- lichen Orten aufstellte und für Veranstaltungen vermietete und die, versehen mit Reißverschlüssen, auch miteinander verbunden werden konnten.
Als er sein Atelier in Paris aufgeben musste, suchte er nach einem Ort, an dem er selbst in einem seiner Volumen leben und experimentieren konnte und fand in La Ferté-Alais bei Paris ein Grundstück, das ihm zur Verfügung gestellt wurde. Dort lebt Hans-Walter Müller seit 1971 und arbeitet an seinen „Gonflables“, erfindet neuartige Befestigungssysteme, tüftelt an Lösungen für den Luftaustausch oder die Druckverluste an Türen und erwarb sich ein technisches Knowhow, das weltweit einmalig ist. Seine Arbeitsweise vergleicht er mit der eines Couturiers, der sein Material auswählt, Schnittmuster entwirft und Kunststoffbahnen zuschneidet, die er mit Hochfrequenzschweißmaschinen zu Räumen und Ensembles verbindet, die aus einer extrem dünnen Haut bestehen. Im Gegensatz zu der den Gesetzen der Schwerkraft unterliegenden „erstarrten“ Architektur, erschafft er leichte, „flüchtige“ Konstruktionen, die in kurzer Zeit an unterschiedlichsten Orten aufgestellt werden können. Im Inneren entstehen durch den Einsatz von unterschiedlich gefärbten, opaken, transluzenten oder transparenten Materialien einzigartige Raumatmosphären, die sich je nach Jahres- und Tageszeit verändern. Das Schönste ist für ihn dabei, wenn er Projektion, Musik und Volumen zusammenführen kann.
Die Ausstellung im aut bietet mit Fotografien, Filmen und Objekten sowie einem eigens für unsere Räume entwickelten Volumen mit Ton und Projektion einen Einblick in das Schaffen dieses Pioniers des Bauens mit Luft. Zeitgleich erscheint eine Publikation von Robert Stürzl, die erstmals auf Deutsch einen detaillierten Blick auf das Lebenswerk des visionären Architekten und Verfechters einer lebendigen Architektur ermöglicht.
Hans-Walter Müller
geb. 1935 in Worms; 1955 – 61 Studium an der Technischen Hochschule Darmstadt; Mitarbeit in verschiedenen Architekturbüros u. a. bei Ernst May; 1961 – 63 Architekturstudium an der École des Beaux-Arts in Paris; parallel dazu Besuch der Vorlesungen von Jean Prouvé an der École des Arts et Métiers sowie Pantomime-Ausbildung bei Étienne Decroux; 1963 – 66 Mitarbeit bei Raymond Lopez, Paris; 1966 – 67 Mitarbeit bei Émile Aillaud, Paris; ab 1961 Experimente mit bewegten Projektionen („Cinimages Fluides©“) und kinetischen Maschinen („Genèse 63“, 1963 und „Machine M“); 1967 Erste aufblasbare Volumen („Volux©“); seither zahlreiche Tragluftvolumen u. a. für Wandertheater, Ausstellungen und Events weltweit; parallel dazu Bühnenbilder und Ausstattungen u. a. für die Comédie-Française, die Pariser Opern, das Nationaltheater München und Florenz sowie für Ballette von Maurice Béjart, Karin Waehner und Peter Goss; um 1979 Entwicklung der Projektionsmethode „Topoprojection©“; Zahlreiche Workshops mit Studierenden an verschiedenen Architekturschulen in Frankreich; lebt und arbeitet seit 1971 in seinem laufend weiterentwickelten Atelierhaus in La Ferté-Alais bei Paris
Werkauswahl
1965 Entwurf für den Deutschen Pavillon für die Weltausstellung in Montréal (Preisträger, nicht ausgeführt); 1967 Entwurf für die Neue Pinakothek in München; 1968 Erstes Volumen mit Projektionen und kinetischen Maschinen (Wanderausstellung in Frankreich); 1969 L‘Église gonflable, Montigny-lès Cormeilles; 1970 Théâtre expérimentel, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence; 1971 PH3 2000, La Defense, Paris; Temporäres Atelier für Jean Dubuffet, Périgny; Bleu et Blanc, Ivry; 1972 Petite Maison, La Ferté-Alais; 1973 zweigeschoßiges Volumen M210, La Ferté-Alais; 1974 Bühnenüberdachung, Fête de l‘humanité, Paris; 1975 Konzeption, Produktion und Verteilung von 35 aufblasbaren Zelten an Menschen ohne festen Wohnsitz in Paris; La Volière, Tiergarten Saint-Vrain; Topoprojektion „Cathédrale d‘images“, Les Baux; 1979 Salle molle et réspirante für die Ausstellung „Salvador Dali“ im Centre Pompidou, Paris; 1981 Ballon Rouge, Arles; Chaillot 1, Paris; 1982 Centre commercial, Sarcelles; Trocadéro, Paris; Topoprojection „Cathedrale de Troyes“, Troyes; 1983 Airbus, Le Bourget; 1984 Cité des sciences e de l‘industrie (Volumen für zweijährige Wanderausstellung durch ganz Frankreich); 1991 Projektion für Helena Rubinstein in den Steinbrüchen von Les Baux und in Tokyo; „Festival du Vent“, Calvi; 1992 Théâtre itinérant, Olympische Spiele, Barcelona; 1994 Bleu et Rouge, Bern; 1995 Réflecteur Hélium für Yves Saint Laurent; 1996 Topoprojektionen auf das Parlamentsgebäude, San Marino; Théâtre itinérant für Maison de la Culture, Nantes; 1997 Chaillot II für Marionnaud, Paris; 1998 Wandertheater für die Trapezkompanie Arts Sauts; 2000 Agay für Pierre Fakhoury, Neuchatel; 2002 Ballon transparent, Weltumwelttag, Paris; 2005 Ricoré, La Defence, Paris; 2007 Bâteau gonflable, Châlette-sur-Loing; 2009 ADDIM, reisendes Kulturzentrum des Departement Haut-Saône; 2010 Une architecture en mouvement, São Paulo; 2011 Palais de Tokyo Paris; 2015 Pianodrom, Beethovenfest, Bonn; 2016 Volumen für Lacaton & Vassal, Paris; Geflüchtetenunterkunft an der Porte de la Chapelle, Paris; 2018 Le Cyclop Tinguely, Milly-la-Fôret; 2019 Klangstruktur mit Resonanzkugel, La Ferté-Alais
Ausstellungen (Auswahl)
Ausstellungsbeteiligungen u. a. 1963 Galérie Maison des Beaux Arts, Paris; 1965 4. Paris Biennale (Machine M, Preisträger); 1966 „KunstLichtKunst“, Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven; 1967 „Lumière et Mouvement“, Musée d‘Art Moderne, Paris; 1968 „Structures Gonflables“, Musée d‘Art Moderne, Paris; „Science fiction“, Kunstverein Düsseldorf; 1970 Europlastique Paris; 1975 „Surfaces“, Grand Palais, Paris; 2001 „Air en Forme“, Musée de Design e d‘Arts Appliqués Contemporains, Lausanne; 2006 „Paysage habitable“, Centre d‘Art Contemporain, Brétigny-sur-Orge; 2019 „Gigantisme“, FRAC Nord-Pas de Calais, Dünkirchen; Einzelausstellung 2018 „La vie à l‘oeuvre“ CAUE, Lyon
Teilnahmebedingungen: 2G-Nachweis, FFP2-Maske
„Warum aufblasbare Strukturen? Weil sie uns in eine andere Welt entführen, uns zum Nachdenken anregen, uns vergessen lassen, was wir in der Schule gelernt haben. Damit wir wieder wir selbst werden können.“
(Hans-Walter Müller, 1975)
Der Architekt, Ingenieur und Künstler Hans-Walter Müller hat die aufblasbare Architektur zwar nicht erfunden, er hat ihr aber fast sein ganzes Leben verschrieben und dabei ein unglaubliches Œuvre geschaffen. Seit über 50 Jahren setzt er sich mit einwandigen pneumatischen Strukturen auseinander und realisiert Tragluftvolumen für so unterschiedliche Nutzungen wie Ausstellungen, Festivals, Theater- und Konzertaufführungen, aber auch für ein temporäres Einkaufszentrum oder eine zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge.
1935 in Worms geboren, studierte er an der Technischen Hochschule in Darmstadt und ab 1961 an der École des Beaux-Arts in Paris. Hier fand der Visionär und leidenschaftliche Zauberer in der Bewegung der kinetischen Kunst seine künstlerische Heimat. Ausgehend von Experimenten mit Diaprojektionen erfand er 1963 mit der „Genèse 63“ seine erste kinetische Maschine für motorenbetriebene Licht- und Bild-Projektionen, die er 1965 zur „Maschine M“ weiterentwickelte. Lotete er mit dieser vorerst das Potenzial aus, bewegte Bilder auf statische Flächen zu projizieren, so interessierte er sich ab Mitte der 1960er Jahre zunehmend dafür, wie die Architektur selbst bewegt gemacht werden kann. Im Rahmen der Ausstellung „Structures Gonflables“ im Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris, die sich 1968 ganz diesem Thema widmete, stellte er mit „Imaginaire Volux“ erstmals eine Kombination seiner Projektionen mit einem eigens dafür entwickelten Kunststoffvolumen aus. Die Luftzufuhr war so programmiert, dass das Volumen immer wieder zusammensackte und sich danach wieder aufbaute – ein Raum in atmender Bewegung.
Ab diesem Zeitpunkt widmete sich Hans-Walter Müller fast ausschließlich dem Thema der von Luft getragenen Architektur und entwickelte Volumen in immer größeren Dimensionen. Mit einer nicht einmal 40 kg schweren aufblasbaren Kirche erzielte er 1969 erstmals überregionale Bekanntheit. Es folgten erste Aufträge aus der Kunst- und Theaterszene, später auch von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. 1970 produzierte er mit einer Hochfrequenzschweißmaschine ein Volumen über sechseckigem Grundriss in drei Farb- bzw. Materialversionen, die er an unterschied- lichen Orten aufstellte und für Veranstaltungen vermietete und die, versehen mit Reißverschlüssen, auch miteinander verbunden werden konnten.
Als er sein Atelier in Paris aufgeben musste, suchte er nach einem Ort, an dem er selbst in einem seiner Volumen leben und experimentieren konnte und fand in La Ferté-Alais bei Paris ein Grundstück, das ihm zur Verfügung gestellt wurde. Dort lebt Hans-Walter Müller seit 1971 und arbeitet an seinen „Gonflables“, erfindet neuartige Befestigungssysteme, tüftelt an Lösungen für den Luftaustausch oder die Druckverluste an Türen und erwarb sich ein technisches Knowhow, das weltweit einmalig ist. Seine Arbeitsweise vergleicht er mit der eines Couturiers, der sein Material auswählt, Schnittmuster entwirft und Kunststoffbahnen zuschneidet, die er mit Hochfrequenzschweißmaschinen zu Räumen und Ensembles verbindet, die aus einer extrem dünnen Haut bestehen. Im Gegensatz zu der den Gesetzen der Schwerkraft unterliegenden „erstarrten“ Architektur, erschafft er leichte, „flüchtige“ Konstruktionen, die in kurzer Zeit an unterschiedlichsten Orten aufgestellt werden können. Im Inneren entstehen durch den Einsatz von unterschiedlich gefärbten, opaken, transluzenten oder transparenten Materialien einzigartige Raumatmosphären, die sich je nach Jahres- und Tageszeit verändern. Das Schönste ist für ihn dabei, wenn er Projektion, Musik und Volumen zusammenführen kann.
Die Ausstellung im aut bietet mit Fotografien, Filmen und Objekten sowie einem eigens für unsere Räume entwickelten Volumen mit Ton und Projektion einen Einblick in das Schaffen dieses Pioniers des Bauens mit Luft. Zeitgleich erscheint eine Publikation von Robert Stürzl, die erstmals auf Deutsch einen detaillierten Blick auf das Lebenswerk des visionären Architekten und Verfechters einer lebendigen Architektur ermöglicht.
Hans-Walter Müller
geb. 1935 in Worms; 1955 – 61 Studium an der Technischen Hochschule Darmstadt; Mitarbeit in verschiedenen Architekturbüros u. a. bei Ernst May; 1961 – 63 Architekturstudium an der École des Beaux-Arts in Paris; parallel dazu Besuch der Vorlesungen von Jean Prouvé an der École des Arts et Métiers sowie Pantomime-Ausbildung bei Étienne Decroux; 1963 – 66 Mitarbeit bei Raymond Lopez, Paris; 1966 – 67 Mitarbeit bei Émile Aillaud, Paris; ab 1961 Experimente mit bewegten Projektionen („Cinimages Fluides©“) und kinetischen Maschinen („Genèse 63“, 1963 und „Machine M“); 1967 Erste aufblasbare Volumen („Volux©“); seither zahlreiche Tragluftvolumen u. a. für Wandertheater, Ausstellungen und Events weltweit; parallel dazu Bühnenbilder und Ausstattungen u. a. für die Comédie-Française, die Pariser Opern, das Nationaltheater München und Florenz sowie für Ballette von Maurice Béjart, Karin Waehner und Peter Goss; um 1979 Entwicklung der Projektionsmethode „Topoprojection©“; Zahlreiche Workshops mit Studierenden an verschiedenen Architekturschulen in Frankreich; lebt und arbeitet seit 1971 in seinem laufend weiterentwickelten Atelierhaus in La Ferté-Alais bei Paris
Werkauswahl
1965 Entwurf für den Deutschen Pavillon für die Weltausstellung in Montréal (Preisträger, nicht ausgeführt); 1967 Entwurf für die Neue Pinakothek in München; 1968 Erstes Volumen mit Projektionen und kinetischen Maschinen (Wanderausstellung in Frankreich); 1969 L‘Église gonflable, Montigny-lès Cormeilles; 1970 Théâtre expérimentel, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence; 1971 PH3 2000, La Defense, Paris; Temporäres Atelier für Jean Dubuffet, Périgny; Bleu et Blanc, Ivry; 1972 Petite Maison, La Ferté-Alais; 1973 zweigeschoßiges Volumen M210, La Ferté-Alais; 1974 Bühnenüberdachung, Fête de l‘humanité, Paris; 1975 Konzeption, Produktion und Verteilung von 35 aufblasbaren Zelten an Menschen ohne festen Wohnsitz in Paris; La Volière, Tiergarten Saint-Vrain; Topoprojektion „Cathédrale d‘images“, Les Baux; 1979 Salle molle et réspirante für die Ausstellung „Salvador Dali“ im Centre Pompidou, Paris; 1981 Ballon Rouge, Arles; Chaillot 1, Paris; 1982 Centre commercial, Sarcelles; Trocadéro, Paris; Topoprojection „Cathedrale de Troyes“, Troyes; 1983 Airbus, Le Bourget; 1984 Cité des sciences e de l‘industrie (Volumen für zweijährige Wanderausstellung durch ganz Frankreich); 1991 Projektion für Helena Rubinstein in den Steinbrüchen von Les Baux und in Tokyo; „Festival du Vent“, Calvi; 1992 Théâtre itinérant, Olympische Spiele, Barcelona; 1994 Bleu et Rouge, Bern; 1995 Réflecteur Hélium für Yves Saint Laurent; 1996 Topoprojektionen auf das Parlamentsgebäude, San Marino; Théâtre itinérant für Maison de la Culture, Nantes; 1997 Chaillot II für Marionnaud, Paris; 1998 Wandertheater für die Trapezkompanie Arts Sauts; 2000 Agay für Pierre Fakhoury, Neuchatel; 2002 Ballon transparent, Weltumwelttag, Paris; 2005 Ricoré, La Defence, Paris; 2007 Bâteau gonflable, Châlette-sur-Loing; 2009 ADDIM, reisendes Kulturzentrum des Departement Haut-Saône; 2010 Une architecture en mouvement, São Paulo; 2011 Palais de Tokyo Paris; 2015 Pianodrom, Beethovenfest, Bonn; 2016 Volumen für Lacaton & Vassal, Paris; Geflüchtetenunterkunft an der Porte de la Chapelle, Paris; 2018 Le Cyclop Tinguely, Milly-la-Fôret; 2019 Klangstruktur mit Resonanzkugel, La Ferté-Alais
Ausstellungen (Auswahl)
Ausstellungsbeteiligungen u. a. 1963 Galérie Maison des Beaux Arts, Paris; 1965 4. Paris Biennale (Machine M, Preisträger); 1966 „KunstLichtKunst“, Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven; 1967 „Lumière et Mouvement“, Musée d‘Art Moderne, Paris; 1968 „Structures Gonflables“, Musée d‘Art Moderne, Paris; „Science fiction“, Kunstverein Düsseldorf; 1970 Europlastique Paris; 1975 „Surfaces“, Grand Palais, Paris; 2001 „Air en Forme“, Musée de Design e d‘Arts Appliqués Contemporains, Lausanne; 2006 „Paysage habitable“, Centre d‘Art Contemporain, Brétigny-sur-Orge; 2019 „Gigantisme“, FRAC Nord-Pas de Calais, Dünkirchen; Einzelausstellung 2018 „La vie à l‘oeuvre“ CAUE, Lyon
Weiterführende Links:
aut. architektur und tirol