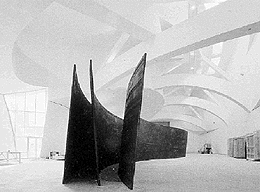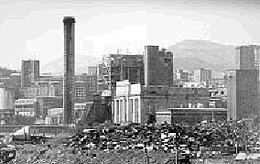Sind Städte heute noch planbar? Kann sich die Architektur gegen den Motor der Stadtentwicklung, die Ökonomie, noch behaupten? Internationale Beispiele zeigen: Es ist möglich - politischen Willen und Lust am Gestalten vorausgesetzt.
Sind Städte heute noch planbar? Kann sich die Architektur gegen den Motor der Stadtentwicklung, die Ökonomie, noch behaupten? Internationale Beispiele zeigen: Es ist möglich - politischen Willen und Lust am Gestalten vorausgesetzt.
Wien ist ruhig, Wien ist musikalisch, Wien ist weit weg - das sind die Stichworte, die amerikanischen Managern zum Thema Wien einfallen. Bei einer Städtebewertung im „Fortune Magazine“ kam Wien zwar kürzlich bezüglich Kultur und Lebensqualität auf den dritten Platz, als Standort für Unternehmen hat die Stadt aber einen ebenso bescheidenen Ruf wie das ganze Land: Die direkten ausländischen Investitionen, ein wichtiger Indikator für wirtschaftliche Attraktivität, haben sich in den letzten Jahren kaum erhöht.
Als Hauptursache werden unflexible bürokratische Abläufe genannt. Die Bewilligung einer Produktionsanlage dauert in Österreich für die Hälfte aller Antragsteller länger als ein Jahr, in Deutschland nur sechs Monate. Solche Bremsmechanismen als Preis für hohe Lebensqualität hinzustellen ist gefährlich: Auf Dauer läßt sich Qualität nicht durch Verhindern sichern, sondern nur durch Gestalten.
Das erfordert keineswegs die Abschaffung der Bürokratie, sondern flexiblere Verfahren und eine Mentalität, die Innovationen gegenüber aufgeschlossen ist. Wenn ein Konzern wie IBM seine Osteuropa-Aktivitäten aus Wien abzieht und in Zukunft von Paris und Stuttgart aus betreiben möchte, ist das ein deutliches Zeichen, daß man diese Innovationskraft hierzulande nicht mehr vermutet.
Was haben solche ökonomischen Entwicklungen mit Städtebau zu tun? Die radikalste Antwort ist, daß sie den Städtebau im klassischen Sinn längst ersetzt haben: die Ökonomie als dominanter Faktor einer Stadt- und Regionalentwicklung, in der Politiker und Architekten bestenfalls an der Oberfläche ein paar Akzente setzen können.
Wer Milliarden zu investieren verspricht, wie Frank Stronach in den Ebreichsdorfer Magna-Globe, trifft auf eine Öffentlichkeit, die keine eigene Vision von innovativem Unternehmertum entwickelt hat und sich deshalb dankbar deren monströse Karikatur verkaufen läßt. Kaum hat die Ebreichsdorfer Kugel konkrete Formen angenommen, finden sich auch in Wien Investoren für ein nicht weniger wahnwitziges Konkurrenzprojekt.
Angesichts solch sprunghafter Entwicklungen stellt sich die Frage, ob Städte überhaupt noch planbar sind. Unterstellt man, daß Politiker sich in ihren Nebensätzen offenbaren, ist die grundsätzliche Skepsis jeder Planbarkeit gegenüber evident: Wo der letzte Bundeskanzler im Falle von Visionen den Arztbesuch empfahl, ließ sein Nachfolger sich gerne mit dem Satz von der Müßigkeit jedes Lebensplans zitieren. Aber natürlich geht es Politikern hier ähnlich wie Architekten: Voraussetzung für ihre Tätigkeit ist die Lust am Gestalten, und die setzt einen Plan voraus. Heute verschieben sich freilich die Gewichte: War es früher üblich, ein Ziel genau zu benennen und dann direkt darauf zuzusteuern, gilt das Interesse von Politikern wie Architekten immer mehr der richtigen „Strategie“ - ein nach außen hin möglichst generell formuliertes Ziel, dafür schnelle Positionswechsel, Ausnutzen gegnerischer Schwächen. Seine architektonische Strategie hat Adolf Krischanitz einmal in einem Interview so beschrieben: Es gehe ihm nicht länger darum, „die Widerstände der Realität zu brechen, sondern ihre Kraft vielmehr - wie in der Judo-Technik - mit einem Minimum an Aufwand umzulenken“.
In diesem Trend lag auch der Wiener Stadtplanungsdirektor Arnold Klotz, als er bei der Schlußdiskussion des fünften Wiener Architekturkongresses erklärte, in Zukunft würde in Wien die „klassische Stadtplanung in die Offensive gehen“, um sich „strategisches Denken und Managementdenken“ anzueignen. Dabei stellt sich vorerst die Frage, welches Denken bisher zur Anwendung kam.
Nachgedacht wurde ja seit Mitte der achtziger Jahre ausgiebig, vorerst über die Expo 95, dann in einem eigenen Fachbeirat über die Stadterweiterung - all das zusätzlich zum Stadtentwicklungsplan. Aber das operative Grundmuster hinter allen Entwicklungsplänen und den Leitzielen des Fachbeirats blieb nach der mißglückten Expo-Volksbefragung die Patchwork-City, die Stadt der kleinteiligen, autonomen Lösungen. Sie zeichnet sich durch Unverbindlichkeit aus: Grundsätzlich ist alles überall irgendwie möglich oder auch nicht.
Als Königsweg der Wiener Stadtplanung gepriesen, war die Patchwork-City - so Erich Raith - doch nie mehr „als die zum Highway erklärte Sackgasse konzeptioneller und formaler Beliebigkeit“. Die Strategie der Patchwork-City ist bestenfalls, daß man keine hat. Arnold Klotz hat konsequenterweise seine Ankündigung einer stärkeren strategischen Ausrichtung der Wiener Stadtplanung mit einer Absage an die Patchwork-City abgeschlossen: Statt dessen werde man sich stärker mit dem „Gesamtbild und mit dem öffentlichen Raum“ befassen.
Sofort stellt sich die Frage: Was ist heute ein Gesamtbild? Beim Kongreß im Architekturzentrum Wien präsentierten Soziologen, Politiker und Architekten Städteporträts, Stadtbilder also, aber wie schon der Titel des Kongresses vermuten ließ, ging es weniger ums Bild als um Prozesse und Operationen: „Hearts of Europe - Bypasses, Implants and Magnets for the Cities“.
Damit ist angedeutet, daß es sich bei radikalen Operationen oft um Notfälle handelt. Wenn Barcelona heute zu Recht als Paradebeispiel einer offensiven Stadtgestaltung gilt, muß man sich die Situation der Stadt nach der Franco-Diktatur in Erinnerung rufen: Die Risiken einer radikalen Erneuerung waren weit geringer als jene einer Stagnation auf dem niedrigen, durch den Madrider Zentralismus der Franco-Ära verstärkten Niveau. Oriol Bohigas, Architekt der urbanen Erneuerung Barcelonas, formulierte eine plakative, reichlich generelle Zielvorgabe: „Das Zentrum hygienisch, die Peripherie monumental.“
Die Umsetzung begann Anfang der achtziger Jahre mit einem „Putsch“, bei dem die bisherige Hierarchie der beamteten Stadtplanung entmachtet und durch ein Team von jungen Architekten ersetzt wurde. Man beauftragte sie mit konkreten, rasch umsetzbaren Projekten für Platzgestaltungen, die bald international Aufsehen erregten. 1986 erhielt Barcelona den Zuschlag für die Olympischen Spiele 1992. Die massiven Investitionen in Infrastruktur, Sportstätten und Wohnbau wurden unter anderem dazu genutzt, benachteiligten Stadtteilen, wie dem desolaten Hafenviertel, eine neue Identität zu geben. Auch wenn nicht alle Realisierungen gleichermaßen überzeugen, ist die Stadterneuerung und Erweiterung Barcelonas ein Beweis dafür, daß Stadtplanung nach wie vor möglich ist.
Die enormen Herausforderungen, denen sich die Planer in diesem Prozeß stellen mußten, hatten einen wichtigen Nebeneffekt: die höhere Qualifizierung der Planer selbst. Das jüngste Stadterweiterungsprojekt, der Delta-Plan für ein Gebiet südlich des Montjuic, in dessen Rahmen bis zum Jahr 2025 unter anderem ein neuer Flughafen und ein Logistikzentrum errichtet werden, wurde in allen seinen Prozessen nach der Qualitätssicherungsnorm ISO 9000 zertifiziert. Im Bestreben, eine „kollektive Kultur der Antizipation“ zu erreichen, schließt dieser Plan Maßnahmen zur postgradualen Fortbildung von Architekten und Planern mit ein.
Das Konzept von Barcelona ist nicht ohne weiteres auf andere Städte übertragbar: Zu unterschiedlich sind die Probleme, die finanziellen Mittel, die Mentalität und die lokale architektonische Kultur, von deren hohem Niveau Barcelona besonders profitierte.
Eine Stadt wie Bilbao mit 25 Prozent Arbeitslosigkeit und einer desolaten Industrie, deren Ruinen das Zentrum prägen, braucht andere Strategien. In einer Art Schocktherapie hat man sich hier entschlossen, mitten ins verwahrloste Zentrum neue kulturelle Einrichtungen zu setzen: Frank Gehrys Museum ist eröffnet, eine neue Oper soll 1998 fertiggestellt werden. Die Präsenz der Architektur, die Rolle des Architekten als Identitätsstifter und Werkzeug des Stadtmarketing hat in Bilbao ein beinahe unheimliches Ausmaß erreicht. Ob diese neuen Bauten nicht doch zu isoliert sind, um eine neue Identität zu schaffen, wird sich erst zeigen. Innenräume wie jene von Gehrys Museum haben aber in jedem Fall das Format, das kollektive Gedächtnis einer Stadt zum Träumen zu bringen.
Ob Barcelona, Bilbao oder Neapel, wo die Substanz der Stadt durch temporäre Installationen von Künstlern wie Mimmo Paladino oder Yannis Kounelis neu ins allgemeine Bewußtsein gehoben werden soll: Am überzeugendsten sind jene urbanen Projekte, die sich als künstlerische Herausforderung deklarieren. Erfolg ist damit keineswegs gesichert: Aber zumindest bleibt ein Freiraum für ein ehrenvolles Scheitern jenseits von Technokratie und bleierner Stadtbild-Etikette.