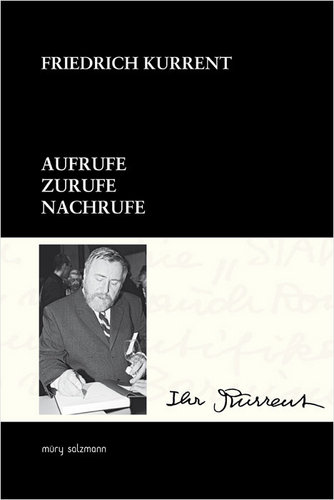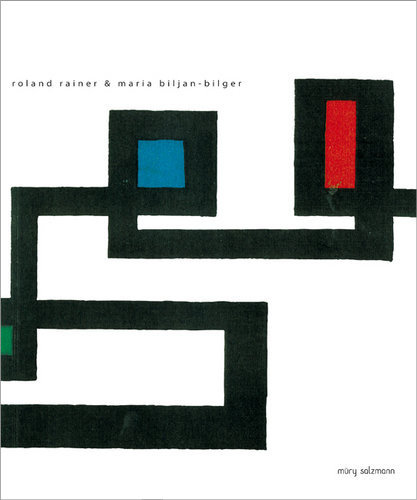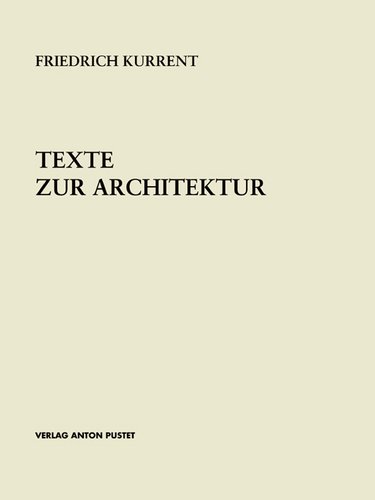Vom Drunter und vom Drüber
Dem Riesenrad fehlt, seit es nach der Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wieder in Schwung gebracht wurde, jeder zweite Waggon. Das Riesenrad ist ein Symbol für Wien: alles halb! Marginalien zur Stadtentwicklung.
Dem Riesenrad fehlt, seit es nach der Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wieder in Schwung gebracht wurde, jeder zweite Waggon. Das Riesenrad ist ein Symbol für Wien: alles halb! Marginalien zur Stadtentwicklung.
Vor 40 Jahren, 1966, hielt ich unter dem Titel „Kontinuität und Diskontinuität der Wiener Stadtentwicklung“ meinen ersten öffentlichen Vortrag. Diesen beendete ich mit der Frage, ob die Kraft der Stadt ausreiche, sich in zwei Richtungen zu entwickeln: nach Süden, wie es Roland Rainer nach dem Vorbild der „Bandstadt“ vorschlug, oder nach Nordosten, über die Donau, wie wir (Johannes Spalt und ich) es in unserem Projekt „Wien der Zukunft - Wien jenseits der Donau“ propagierten.
Als Le Corbusier 1948 seinen einzigen Wiener Vortrag hielt, führte ihn der damalige Senatsrat Johann A. Boeck im Wiener Rathaus zum wandgroßen Stadtplan von Wien mit der Frage, wie und wo sich die Stadt seiner Meinung nach erweitern solle. Le Corbusier deutete weit hinaus nach Transdanubien und machte mit der Hand, einem Kreissegment folgend, punktuelle Drehbewegungen. Diese sollten raumabsteckende Hochhausgebilde bedeuten, vielleicht solche, die man von seinem „Plan Voisin“ für Paris kannte?
In unserem Zukunftsprojekt vor 40 Jahren dachten wir an ein donaustädtisches Zentrum am nordöstlichen Gestade, am stillen Wasser der Alten Donau, das offen nach Südwesten für den gesamten drüberen Stadtteil von Floridsdorf bis Kagran und Stadlau ein zweites Wiener Stadtzentrum für Transdanubien hätte werden sollen. Im Rücken der ergänzte Gürtel, daran anschließend die neue „Donau-Universität“. Eben nicht ein isoliertes Hochhauszentrum mit Bürotürmen, wie sie auf der sogenannten „Platte“ in den vergangenen 15 Jahren entstanden sind, sondern das Herz einer neuen drüberen Stadt mit den Lungenflügeln stadtlandschaftlicher Erholungsflächen.
Die Schließung des Gürtels jenseits der Donau, zwischen Stadlau, Kagran und Floridsdorf, ist der Wiener Stadtplanung bis heute nicht gelungen. Die jetzt „Donau-City“ genannte Bebauung auf der „Platte“ hat ihre eigene Entstehungsgeschichte: Hier sollte 1995 eine gemeinsame Weltausstellung „Wien-Budapest“ stattfinden. Die Planungen und der Wettbewerb dazu waren weit gediehen. Nach dem Durchzwicken des Eisernen Vorhangs im Jahre 1989 änderte sich die Interessenslage; 1991 wurde das Expo-Projekt in einer Volksabstimmung hinterfragt. Die Wiener sagten nein.
Die Donauufer-Autobahn wurde überplattet, die darüberliegenden und anschließenden Gründe verkauft; auf die Platte setzte sich die „Donau-City“ - das propagierte „Neue Wien“ im Schaufenster gegenüber der alten Stadt. Die Hochhaus-City zwischen Donau und Alter Donau ist aber isoliert! Sie zeigt sich arrogant in ihrer Isolation. So stellt sich seither ein Hochhaus vor das andere. Die Letzten werden die Höchsten sein. Aber Wien ist nicht New York.
Hochhaus-Massierungen? Damit ist es so eine Sache. Wien schreit nicht danach. München auch nicht. Trotzdem ist da wie dort alles in diese Richtung im Gange, alles im Schwange. Dass man damit vor wenigen Jahren zu nahe an die Innenstadt heranrücken wollte, führte zu einem Eklat mit der Hochhausgruppe „Wien-Mitte“ hinter dem Wienfluss an der Landstraßer Hauptstraße/Marxergasse. Das nächste städtebauliche Desaster ist in der Gegend des neuen Wiener Zentralbahnhofs vorprogrammiert, der bekanntlich anstelle von Süd- und Ostbahnhof errichtet werden soll. Die Diagonallage des künftigen Bahnhofs zwischen Gürtel und verlängerter Prinz-Eugen-Straße, also schräg gegenüber dem Oberen Belvedere, lässt ein dreieckiges Grundstück frei, das mit elf Hochhäusern mit einer Höhe von bis zu 100 Metern besetzt werden soll. Von offizieller Seite wird proklamiert, dass alles aus der historischen Sichtachse gerückt sei. Dabei wird vergessen, dass der moderne Mensch von überallher überallhin schaut, dass dort die Anhöhe erreicht ist, auf der sich Prinz Eugen sein Schloss und seinen ansteigenden Garten errichten ließ, um „in die Stadt“ zu seinen Füßen hinunterzublicken. Die geplante Hochhausgruppe würde unweigerlich eine schwere Störung der einmaligen topografischen Situation dieses Stadtgebietes verursachen.
Das Wiener Hochhaus-Problem wird auch am „Florido Tower“ ersichtlich, der ortlos irgendwo in Floridsdorf herumsteht. Der 200 Meter hohe „Millennium Tower“ am stadtseitigen Ufer ist im Bezirk Brigittenau immerhin ansatzweise städtebaulich verankert; von Norden begrüßt er die Anreisenden, von Süden betrachtet, fährt er mit seiner ganzen Höhe in die einprägsame Silhouette von Leopoldsberg-Kahlenberg gnadenlos hinein.
Es ist bedauerlich, dass heutige Stadtplanung die wunderbare topografische Situation der Stadt Wien kaum oder gar nicht berücksichtigt. So finde ich Hochhäuser auf den Wiener Stadtbergen, Hügelzügen, Stadterhebungen (Beispiel neues AKH) falsch. Falsch am Wienerberg; falsch am Laaer Berg. Das bedeutet nicht, dass eine niedrige Bebauung diesen Höhenrücken hinunter nach Süden bis zur Stadtgrenze nicht legitim wäre, wie sie sich ja etwa bereits von Liesing bis Oberlaa erstreckt. Die wunderbare Umfassung der Stadt durch den Wienerwald, beginnend am Leopoldsberg, Kahlenberg im Norden, weitergeführt im Westen, mit der Fortsetzung im Süden, eben mit Wienerberg und Laaer Berg, verleiht der Stadt Wien ihre einmalige Einbettung in das gesamte Gebiet rechts der Donau und seine Öffnung über den Strom hinweg, südlich des Bisamberges ins flache, erhebungslose ideale Erweiterungsgebiet links der Donau, weit hinaus ins Marchfeld.
Wenden wir uns dem Donaukanal zu: Das vorausschauende Wettbewerbsprojekt von Lois Welzenbacher aus dem Jahr 1946 wollte die geschwungene Linie des (1944 durch Bombenabwürfe zerstörten) Kanals rhythmisch mit quergestellten höheren Häusern begleiten und akzentuieren. In der Bautätigkeit der Sechziger- und Siebzigerjahre wurde davon nichts aufgenommen; sperrige Bürokästen riegeln den zweiten Bezirk, die Leopoldstadt, ab; das schützenswerte Dianabad wurde vernichtet.
Erst die jüngere Zeit findet dort ein Betätigungsfeld: das Bürohaus „k47“ anstelle des „Kai-Palastes“, eines frühen Eisenbetonbaus, errichtet; das X-beinige Uniqa- Bürohaus mit der aufgerissenen Brust gegenüber der Urania; und das derzeit vor Baubeginn stehende, von Jean Nouvel geplante hohe Gebäude Ecke Taborstraße/Donaukanal. Allerdings wäre, das letzte Beispiel betreffend, das Wettbewerbsprojekt des Spaniers Rafael Moneo aus städtebaulichen Gründen vorzuziehen gewesen, weil es statt 70 Metern nur eine Höhe von 50 Metern erreicht und den anschließenden zweiten Bezirk besser „hereingeholt“ hätte.
Parallel zur Ende der Sechzigerjahre einsetzenden U-Bahn-Streckennetz-Diskussion entwickelten Hermann Czech, Hugo Potyka, Johannes Spalt und ich eine nichtamtliche U-Bahn-Netz-Studie. Dabei gingen wir von gerade verlaufenden Durchmesserlinien aus, die sich, drei an der Zahl, in der Inneren Stadt an drei Punkten kreuzen sollten: am Stephansplatz, am Albertinaplatz und an der Freyung, in Verbindung mit, wie ja verwirklicht, den Radiallinien (Zweier-Linie, heute U2), der Gürtel-Stadtbahn-Linie, der Wientallinie und der Vorortelinie aus der Otto-Wagner-Zeit.
Die Planungsgeschichte zeigt, wie richtige Ansätze mit politischen beziehungsweise stadtpolitischen Realitäten verquickt werden und wurden. So wurde die heutige Linie U1, vom Stephansplatz, Praterstraße, Praterstern nach Nordosten über die Donau ab Stephansplatz in Gegenrichtung nach Favoriten bis Reumannplatz nach Süden hin gebogen, weil dort der starke sozialistische ehemalige Arbeiterbezirk Favoriten auf eine frühe öffentliche Verkehrsanbindung pochte. „Unsere“ Linie hätte schnurgerade über die Mariahilfer Straße zum Westbahnhof weitergeführt. Aber wenn man einmal mit dem Verbiegen anfängt, ist man verurteilt weiterzubiegen. So wurde die aus dem südöstlichen Erdberg kommende heutige Linie U3 ab Stephansplatz nicht mit den nordwestlichen, sondern mit den westlichen Bezirken verbunden. „Unsere“ Erdberger Linie wäre wiederum ab Stephansplatz schnurgerade nach Währing in den Nordwesten weitergefahren.
In der ersten amtlichen Planungsphase fuhr man unter der Lindengasse am Westbahnhof glattweg vorbei. Erst nach harten Diskussionen wurde zur Mariahilfer Straße zurückgebogen und der Westbahnhof dann doch noch erreicht. Dass diese Linie später (angeblich nach einer Idee des damaligen mächtigen Finanzstadtrats Hans Mayr) weiter zum ehemaligen Arbeiterbezirk Ottakring hinübergebogen wurde, war eine weitere Konsequenz des Wiener Biegeplans.
Auch die derzeit in Bau befindliche Verlängerung der U2 (bislang am Donaukanal beim Ringturm endend) in den zweiten Bezirk mit den Stationen Taborstraße, Praterstern, Prater, Messegelände, Stadion, dann die Donau überquerend nach Stadlau und später nach Aspern in Wien-Donaustadt (ehemaliges Flugfeld, derzeitiges Hoffnungsgebiet) ergibt eine geschlängelte, gebogene Wiener Linie.
Und nun zum größten Schildbürgerstreich seit drei Jahrzehnten: Den Süd- und Ostbahnhof erreicht man mit der U-Bahn nicht. Die Linie U1, die Station Südtirolerplatz, ist viel zu weit vom Bahnhof entfernt, man müsste von dort seine Koffer eine gute Viertelstunde schleppen. Neben einigen Gürtel-Tramlinien erreicht nur die gemütliche Straßenbahnlinie D, aus der Heurigengegend Nussdorf kommend, den Bahnhof. Der D-Wagen soll auch dem neuen Zentralbahnhof weiterhin die angeheiterten Fahrgäste liefern. Dabei wäre es ein Leichtes gewesen, die U2 von der derzeitigen Wende- und Endstelle am Karlsplatz unter der Prinz-Eugen-Straße bis zum Bahnhof zu verlängern.
Schilda grüßt Wien.
Ein großes Plus gebührt hingegen der architektonischen Gestaltung der U-Bahn-Stationen. Dass Ende der Sechzigerjahre erreicht wurde, einen Architektenwettbewerb auszuloben, nachdem bereits alles in alleiniger Hand der Tiefbauer zu einer Tiefbauangelegenheit zu werden drohte, wurde den Stadtbehörden buchstäblich in letzter Minute abgerungen. Die bis heute aktive Arbeitsgruppe U-Bahn, bestehend aus den ersten und zweiten Preisträgern (Wilhelm Holzbauer, Heinz Marschalek, Georg Ladstätter, Norbert Gantar), leistete und leistet gute baulich-architektonische Arbeit. Auch spätere Stationsplaner von Teillinien (U6 nach Siebenhirten von Johann Georg Gsteu, verlängerte U2 von Paul Katzberger) setzten und setzen mit architektonischer Qualität fort. Man muss sich, um die Wichtigkeit einer derartigen Aufgabe für eine Stadt zu begreifen, nur die Stadtbahnbauten von Otto Wagner vor Augen führen, die die Physiognomie des Stadtkörpers bis heute entscheidend prägen.
Die Eingangsfrage aus dem Jahre 1966, vor 40 Jahren, ob die Kraft der Stadt ausreiche, sich in zwei Richtungen zu entwickeln, nach Süden und nach Nordosten, über die Donau, ist erstaunlicherweise durch die Realität der vergangenen Jahrzehnte nach beiden Richtungen beantwortet worden.
Die Frage, ob dadurch der Stadtorganismus einer ihm eingeschriebenen Kontinuität gefolgt ist oder ob er sich diskontinuierlich entwickelt hat, ist trotzdem zu stellen. Falsche städtebauliche Maßnahmen erzeugen oft einen „Kropf“ in der Stadt. Man kann diesen schon tragen, aber schön ist er nicht. Eine Stadt ist wie ein Lebewesen; Verwachsungen werden im Laufe der Zeit wieder ausgeglichen. Diskontinuitäten können wieder gemildert und in eine kontinuierliche Stadtentwicklung eingebunden werden.
So finde ich großmaßstäbliche hohe Bauten am Wiener Südrand - wie schon gesagt - aus städtebaulich-landschaftlich-topografischen Gründen falsch, mögen sie auch für sich genommen von guter architektonischer Qualität sein. Der Stadt sind dort Kröpfe zugewachsen.
Über die Donau, nach Nordosten hin, wo in den späten Sechzigerjahren in Floridsdorf (Großfeldsiedlung), Kagran, Stadlau bis Aspern und Essling Neubebauungen begannen, überschlugen sich später die baulichen Aktivitäten. Auf der Platte liefern sich Wiener und internationale Stararchitekten ein Kräftemessen, dass man als Zuschauer nur staunen kann.
Der Traum von einer Stadt jenseits der Donau, wofür es sich ausgezahlt hätte, die Kräfte der Stadt zu bündeln, der Traum von einem Neu-Wien erfüllte sich (bisher) nicht. Es wurde in zwei Richtungen investiert, dadurch halbierten sich die Kräfte.
Alles halb.
Dem Riesenrad fehlt, seit es nach der Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wieder in Schwung gebracht wurde, jeder zweite Waggon. Das Riesenrad ist ein Symbol für Wien.
Alles halb.
Spectrum, So., 2006.09.10