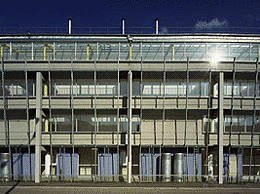Stadt statt Knast
Die Justizanstalt Josefstadt ist bald das am besten mit öffentlichem Verkehr erschlossene Gefangenenhaus der Welt. Wohl nicht nur aus städtebaulicher Sicht wird hier eine Chance vertan. Noch wäre Zeit umzudenken.
Die Justizanstalt Josefstadt ist bald das am besten mit öffentlichem Verkehr erschlossene Gefangenenhaus der Welt. Wohl nicht nur aus städtebaulicher Sicht wird hier eine Chance vertan. Noch wäre Zeit umzudenken.
Im STANDARD vom 15. Oktober konnte man einen Bericht über die Sanierungspläne für das Graue Haus lesen. Demnach soll die Justizanstalt Josefstadt bis zum Jahr 2032 und das Landesgericht für Strafsachen in Wien bis 2027 generalsaniert werden, weil die baulich-räumlichen Zustände nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und weil bei permanenter Überbelegung Raumnot und hygienische Missstände bestehen. Die dafür vorerst veranschlagten Kosten: 200 Millionen Euro.
Maximal verdichtet
Fest steht, dass die räumlichen Ressourcen des Standorts ausgereizt sind. Erweiterungsoptionen nach außen bestehen im dicht verbauten Stadtquartier nicht. Der Innenbereich des in den 1830er-Jahren jenseits des Glacis errichteten und später mehrfach erweiterten und aufgestockten Gebäudekomplexes wurde bereits ab den 1980er-Jahren mit Zellentrakten maximal nachverdichtet. Zwischen den Zeilen war daher unübersehbar zu lesen, dass die standortbedingte Raumnot der Justizanstalt auch weiterhin problematisch bleiben wird. In Kreisen der Justiz herrscht dennoch berechtigte Freude über die lang ersehnte Finanzierungszusage.
Als Stadtplaner kann man diese Freude nur bedingt teilen. Da überwiegt die Befürchtung, dass gerade eine einmalige Chance vergeben wird, umfassendere und nachhaltigere Verbesserungen zu bewirken.
Neuer Verkehrsknoten
Ebenfalls um sehr viel Steuergeld wird nämlich gerade südlich der Justizanstalt der Verkehrsknoten „Rathaus“ gebaut, an dem sich die U-Bahn-Linien U2 und U5 kreuzen werden. Gleich nördlich der Anstalt wird die U5-Station „Frankhplatz / Altes AKH“ entstehen. Dazu kommen Straßenbahnstationen im unmittelbaren Umfeld sowie der nur etwa 500 Meter entfernte Verkehrsknoten „Schottentor“, an dem insgesamt 13 Linien des öffentlichen Verkehrs zusammenkommen (die U-Bahn-Linie U2, die Straßenbahnlinien D, 1, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 und 71, die Buslinien 1A und 40A).
Wien wird also eine neue Attraktion bekommen: das am besten mit öffentlichem Verkehr erschlossene Gefangenenhaus der Welt. Wie schade, dass die Insassen der Strafanstalt nicht in der Lage sein werden, diese außergewöhnliche Erschließungsqualität auszunützen. Noch bedauerlicher ist, dass an diesem Standort nicht jener pulsierende Brennpunkt städtischen Lebens aufblühen wird, für den gerade die besten infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden.
Mag sein, dass es noch keine Gespräche zwischen der Stadtplanung und den Justizbehörden über Optionen einer Verlegung der Justizanstalt gegeben hat, obwohl diese Idee nicht neu ist: Schon im „Masterplan Glacis“, der 2014 von der Stadtentwicklungskommission einstimmig zur Kenntnis genommen und dann im Wiener Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, steht: „Mit der Rossauer Kaserne, dem Landesgericht für Strafsachen und der Stiftskaserne bestehen im Rand- und Nahbereich des Stadtraums Glacis großflächige Gebäudekomplexe mit isolierten, nicht öffentlich zugänglichen Nutzungen, deren Standorte sich für neue Funktionen aus dem angestrebten Schwerpunktbereich Kunst, Kultur und Wissenschaft gut eignen würden.“
Offener Ort
Im Sinn dieses städtebaulichen Leitbildes wäre demnach zu überprüfen, wie das verschlossene Graue Haus mit angemessenem Aufwand in einen offenen Ort der Kultur und der Wissenschaft verwandelt werden könnte. Es wäre im Wortsinn naheliegend, dabei den steigenden Raumbedarf der Universität Wien zu bedenken. Der Standort liegt ja ideal zwischen dem Uni-Hauptgebäude am Ring, dem Neuen Institutsgebäude an der Universitätsstraße und dem Campus des Alten AKH. Dort wurde bereits in den 1990er-Jahren vorbildlich vorgezeigt, wie die Transformation eines schwierigen Baubestandes auf stadtstruktureller, gebäudetypologischer und architektonischer Ebene zu bewerkstelligen ist.
Eines ist sicher: Wenn jetzt 200 Millionen Euro in die Sanierung der Justizanstalt investiert werden, dann ist dieses Thema für Generationen erledigt. Da die Bauarbeiten aber ohnehin frühestens in einem Jahr beginnen sollen, könnte man doch eine jener bewährten Wiener „Nachdenkpausen“ einschieben und überlegen, wie man eine viel überzeugendere Win-win-win-Situation erreichen könnte:
■ Durch die Verlegung der Justizanstalt an einen entwicklungsfähigeren Standort könnte eine in jeder Hinsicht zukunftsweisende architektonische Neuinterpretation dieser herausfordernden Bauaufgabe verwirklicht werden.
■ Aus der düstergrauen Haftanstalt könnte ein funkelnder, in die Stadt ausstrahlender und stadtstrukturell perfekt integrierter Puzzlestein im Cluster der kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen der Glacis-Zone werden, der besonders dem Raumbedarf der Universität zugutekommen könnte.
■ Durch die allseitige Öffnung des alten festungsartigen Gebäudekomplexes, durch die Wiedergewinnung wohlproportionierter Innenhöfe mit bester Aufenthaltsqualität und im Zusammenspiel mit dem ebenfalls am Außenrand des Glacis liegenden Museumsquartier könnte Wien einen weiteren „jungen“, sozial und funktionell vielschichtigen und durch seine symbolträchtige Verwandlung besonders inspirierenden Anziehungspunkt bekommen. Für die optimale Verkehrsanbindung wäre ja bereits gesorgt.
[ Erich Raith ist Architekt, Stadtplaner, Stadtforscher. Er war bis 2019 Professor am Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen der TU Wien. ]
Der Standard, Sa., 2021.10.30