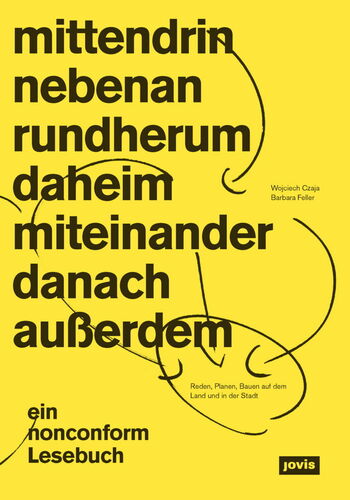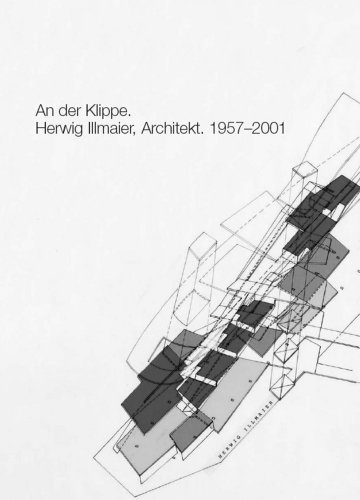Wie mit NS-kontaminierten Gebäuden umgehen?
Im nächsten Jahr wird vielerorts wieder verstärkt an das Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft erinnert werden, die vor 80 Jahren zu Ende ging....
Im nächsten Jahr wird vielerorts wieder verstärkt an das Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft erinnert werden, die vor 80 Jahren zu Ende ging....
Im nächsten Jahr wird vielerorts wieder verstärkt an das Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft erinnert werden, die vor 80 Jahren zu Ende ging. Damit wird auch der Blick auf die baulichen Zeugnisse dieser Zeit abermals intensiviert werden und der Umgang mit diesem belasteten Erbe in den Fokus rücken. Der unlängst erschienene Sammelband ›Ver/störende Orte. Zum Umgang mit NS-kontaminierten Gebäuden‹ tut dies schon heute. Er ist die Dokumentation einer zweiteiligen Tagung, die im Herbst 2021 in Innsbruck und Linz stattgefunden hat, veranstaltet von der Universität Innsbruck, der Kunstuniversität Linz sowie dem Haus der Geschichte Österreich. Anlass waren die dort befindlichen Gebäude, die bereits die Bandbreite der Fragestellungen aufzeigen: das als Gauhaus für Tirol und Vorarlberg errichtete heutige Tiroler Landhaus, die jetzt von der Kunstuniversität Linz genutzten ehemaligen Linzer Brückenkopfgebäude, sowie der Altan der Neuen Burg in Wien, der als ›Hitlerbalkon‹ zu einem ikonografischen Bild der NS-Zeit in Österreich wurde. Es geht in den zahlreichen Beiträgen also sowohl um Gebäude, die in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft errichtet wurden als auch um jene, die vom NS-Regime intensiv und bildprägend vereinnahmt und damit – aus heutiger Sicht – ›kontaminiert‹ wurden.
Der Fokus der versammelten Texte liegt auf der Frage, wie ein angemessener Umgang mit diesem baulichen Erbe heute aussehen kann, wobei die Dokumentation der jeweiligen Bau- und Nutzungsgeschichten nicht zu kurz kommt. Dabei wird deutlich, dass die oftmals als Täterorte wahrgenommenen Gebäude zumeist auch eine Opfergeschichte haben, denn ihre Errichtung erfolgte vielfach durch Zwangsarbeiter:innen und Kriegsgefangene, zudem kamen oftmals auch Materialien zum Einsatz, die etwa in Konzentrationslagern abgebaut wurden.
Erkenntnisreich sind die Darstellungen der jeweiligen Nutzungsgeschichten, die sich auffallend ähneln: in den unmittelbaren Nachkriegsjahren dominierte ein pragmatischer Zugang, bei dem die Gebäude der NS-Zeit häufig für öffentliche Zwecke genutzt wurden. Dies geschah zumeist ohne große Veränderungen bzw. lediglich der Entfernung von dezidierter NS-Symbolik. Auf den Kontext ihrer Errichtung wurde nicht verwiesen. Erst spät, ab den 1990er Jahren, stellten sich Fragen nach der Erinnerungskultur sowie dem adäquaten Denkmalschutz. Man würde denken (oder hoffen), dass Verweise auf die Er-
richtungs- bzw. Nutzungsverhältnisse – sei es in Form von erklärenden Texten oder künstlerischen Interventionen – eine Selbstverständlichkeit wären. Dass dies jedoch bis heute keineswegs der Fall ist, verdeutlichet der Sammelband sowohl anhand der Bauten in Linz und Innsbruck als auch des Rathauses in Dornbirn (dem früheren Kreisleitungsgebäude der NSDAP), Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn oder der NS-Bauten in Weimar.
Die Formulierung der Herausgeber:innen im Vorwort, dass »Unsichtbarmachung und Nichtkommentierung« heute keine Optionen mehr sind und es darum geht »die Geschichte der Bauten sowie ihre Bedeutung für das NS-Gewalt- und Terrorsystem multiperspektivisch wahrnehmbar« zu machen, ist daher wohl weniger als Tatsache, denn als Appell zu verstehen.
Besonders einprägsam sind jene Texte, die sich mit dem denkmalpflegerischen Umgang mit den ungeliebten Gebäuden beschäftigen. Sie zeigen das Spannungsverhältnis von Bewahren/Erhalten und Transformieren/Umgestalten. Insbesondere die zwei Gespräche mit Paul Mahringer (Leiter der Abteilung für Denkmalforschung des Bundesdenkmalamts) sowie mit Walter Hauser (von 2014 bis 2023 Landeskonservator in Tirol) verdeutlichen sowohl die aktuellen Herausforderungen und die Komplexität der Aufgabenstellung als auch die Veränderungen im Denkmalbegriff (siehe dazu Philipp Oswalt: Über die Notwendigkeit symbolischer Eingriffe in schwierige Denkmale in dérive 96, S. 13–18).
Denn mit zunehmendem Abstand zur Entstehungszeit werden die Forderungen nach einer möglichst originalgetreuen Sicherung des Gebäudebestandes lauter und speziell bei den Gebäuden der NS-Zeit ist der Grat zwischen einer damit möglichen ›Überhöhung‹ und der Dokumentation und Sichtbarmachung der intendierten Propagandawirkung und Machtdemonstration besonders schmal.
Speziell nachvollziehbar wird dieses Spannungsfeld anhand der monumentalen Baulichkeiten für die Reichsparteitage in Nürnberg, welches Martina Christmeier (wissenschaftliche Mitarbeiterin des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände in Nürnberg) in ihrem Aufsatz aufzeigt. Sie zeichnet die Entstehungsgeschichte des Projekts von Günther Domenig nach, der sich 1998 mit seiner radikalen Intervention, die die Macht der rechten Winkel und Achsen durchbricht, im geladenen Architekturwettbewerb durchsetzen konnte. Aktuell wird das Dokumentationszentrum einer sowohl inhaltlichen als auch baulichen Neugestaltung unterzogen und an die heutigen Erfordernisse angepasst, die etwa eine größere Niederschwelligkeit als auch die Einbeziehung breiterer Kreise von Nutzer:innen ermöglichen sollen. Neben Nürnberg und Weimar weiten auch Beiträge über die faschistischen Baurelikte in Bozen sowie dem Tal der Gefallenen nahe Madrid – dem zentralen Herrschaftssymbol der Franco-Diktatur – den Blick über die Grenzen, der durchaus etwas ausführlicher ausfallen hätte können.
Die insgesamt sehr differenzierten und vielschichtigen Analysen öffnen die Augen für ein Themenfeld, dem bisher eher geringe Aufmerksamkeit zuteilwurde. Die Herausgeber:innen hoffen, dass in Zukunft »den steinernen Zeugen der
NS-Terrorherrschaft in Österreich und Deutschland eine deutlich aktivere Rolle bei der Aufklärung und Vermittlung über die NS-Verbrechen« zukommen wird und die öffentliche Hand mit wegweisenden Projekten vorangeht.
—
Ingrid Böhler, Karin Harrasser, Dirk Rupnow, Monika Sommer, Hilde Strobl (Hg.)
Ver/störende Orte. Zum Umgang mit NS-kontiminierten Gebäuden
Wien, Berlin: Mandelbaum Verlag, 2024
25 Euro, 260 Seiten
dérive, Fr., 2024.10.18
verknüpfte Zeitschriften
dérive 97, Energie