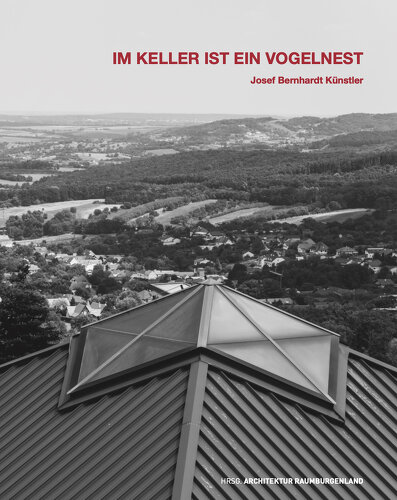Perfekte Neugestaltung: Ein Hof der Ruhe für Sankt Pölten
Wenn ein Architekt mit besonderem Gestaltungswillen auf einen Bauherrn mit hohem Qualitätsbewusstsein, trifft, entsteht Gutes: Der neu gestaltete Brunnenhof des Bistumsgebäudes in St. Pölten lädt nun zum Verweilen ein.
Wenn ein Architekt mit besonderem Gestaltungswillen auf einen Bauherrn mit hohem Qualitätsbewusstsein, trifft, entsteht Gutes: Der neu gestaltete Brunnenhof des Bistumsgebäudes in St. Pölten lädt nun zum Verweilen ein.
Die Innenstadt von St. Pölten ist vermutlich das am besten erforschte Flächendenkmal Österreichs. Einen großen Teil machen die Bistumsgebäude und seine Leerräume, die Höfe, aus. Seit 1785 Bischofssitz, fand der Bischof damals Platz in einem von Joseph II. gerade aufgelassenen Augustiner-Chorherrenstift aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Dieses Kloster hatte einen bedeutenden mittelalterlichen Vorgänger, nämlich das Hippolyt-Kloster aus dem 8. Jahrhundert (St. Hippolyt wurde zu St. Polyt und zu St. Pölten). Vom alten Kloster aus entwickelte sich der mittelalterliche Siedlungskern der Stadt. Zum Zeitpunkt der Klostergründung war die Gegend nicht besiedelt, obwohl dort vor der Völkerwanderung eine durchaus bedeutende römische Stadt namens Aelium Cetium bestanden hatte. Das exakte Gründungsjahr des Hippolyt-Klosters liegt bis heute im Dunkeln. Erstmals urkundlich erwähnt wird ein Stift an der Traisen im Jahr 976, das Kloster hat aber wohl bereits einige Zeit davor existiert. Obwohl schriftliche Quellen fehlen, wird eine Gründung um das Jahr 800 angenommen.
Das Gebiet befand sich im 8. Jahrhundert an der Schnittstelle des Karolingerreiches im Westen mit dem byzantinischen Reich im Osten. Herrscher der östlichen Provinzen entlang der Donau waren damals die Awaren, ein zentralasiatisches Steppenvolk mit einem Kaghan als Fürsten. Die Awaren hatten sich aus dem großen Heeresverband der Hunnen herausgelöst und siedelten in der ungarischen Tiefebene. Karl der Große startete im Jahr 791 den Awarenfeldzug und drängte dabei die Awaren tief nach Osten zurück. Damit wurde der heutige niederösterreichische Zentralraum ein Teil des christlichen Frankenreiches. In diesem neu dazugewonnenen Gebiet gründete das baierische Kloster Tegernsee das spätere Stift St. Pölten. Die Tegernseer Mönche und ihre adeligen fränkischen Äbte brachten auch die Reliquien des hl. Hippolyt direkt aus Rom an die Traisen. Später ging das Hyppolit-Kloster an den Bischof von Passau über.
Drei große Klosterhöfe
Zahlreiche archäologische Grabungen bestätigten durch Lage und Größe des mittelalterlichen Klosters diese Dokumente. Die Kirche war eine dreischiffige flachgedeckte romanische Kirche mit dreiteiligem Apsidenchor. Ein Querschiff gab es nicht, jedoch eine Doppelturmfassade mit Westwerk und Trichterportal.
Ab 1209 fanden an der in die Jahre gekommenen romanischen Kirche und dem Kloster umfangreiche Baumaßnahmen statt. Der heutige Hauptchor der Kirche entstand, das Innere der Stiftskirche wurde frühgotisch überarbeitet. Die mittelalterliche Klosteranlage befand sich nördlich der Kirche. Der Kreuzgang aus der Barockzeit, den man heute noch durchschreiten kann, war kleiner als der mittelalterliche Kreuzgang. Neben dem Nordschiff der Kirche befand sich die Heilig-Geist-Kapelle, anschließend kamen der Kapitelsaal und das Calefactorium, die Wärmestube des Klosters, damals der einzige beheizte Raum des Komplexes. Dort durften sich neben den Mönchen und den Familiaren – also nicht geweihte Laienmitglieder von Ordensgemeinschaften, die außerhalb des Klosters wohnten – auch Bedürftige wie Wohnungslose während des Tages aufhalten. Das Refektorium schloss direkt an. Beim verheerenden Stadtbrand von 1621 wurde die mittelalterliche Klosteranlage stark zerstört, nur die Kirche blieb weitestgehend verschont. Das Kloster wurde in seiner heutigen Pracht im Barockstil wiederaufgebaut.
Der rechteckige Brunnenhof ist einer von drei großen ehemaligen Klosterhöfen, aus denen die Kernstadt entstand, und hat drei große, rundbogige Durchfahrten, die zur Bischofsallee, zum Binderhof und Domplatz führen. In der Mitte des Brunnenhofs steht auf einem zweistufigen Podest ein Brunnen aus Wachauer Marmor, in dessen Mitte sich eine Steinsäule mit vier wasserspeienden Engelsköpfen befindet. Gebaut wurde er zwischen 1653 und 1672. Bis vor Kurzem war die Gestaltung des Hofs nichtssagend; Letzterer diente als Durchgangsachse und vorrangig als Parkplatz.
Das Büro X Architekten ist ein Zusammenschluss mehrerer Partner mit Sitz in einigen Landeshauptstädten und Hauptsitz in Linz. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Sakralbau, Projekte werden über Wettbewerbe requiriert. Der Brunnenhof war eine indirekte Folge eines gewonnenen Wettbewerbs für die Wallfahrtkirche Kirche Mank. In St. Pölten geschah dann das, was immer geschieht, wenn gute Architektur entsteht: Ein Architekt mit besonderem Gestaltungswillen, nämlich Lorenz Promegger von X Architekten, traf auf einen Bauherrn mit hohem Qualitätsbewusstsein, nämlich Philipp Orange, Bauamtsleiter der Diözese Linz.
Längste Sitzbank des Landes
Die zentrale Idee von X Architekten lässt sich mit einer altgriechischen Metapher beschreiben: Das Wort Pneuma oder Geist, Hauch, Luft, Atem bezeichnet ein mit der Atemluft aufnehmbares Lebensprinzip. Aus den zwei Elementen Einatmen und Ausatmen entsteht ein Prinzip der Verwandlung. Etwas – Architektur – ist da und wird durch architektonische Interventionen im Umfang entweder reduziert oder erweitert. Der namensgebende Brunnen etwa wurde als Bodenkreis aus Wachauer Marmor in die Hoffläche hinein ausgedehnt und zieht sich dadurch optisch stärker in den Hofraum hinein. Auch der Farbton der Fassade dehnt sich über den Hofboden aus. Damit diese Flächen wachsen konnten, mussten andere Flächen, etwa der Asphaltbelag, bis hin zum Verschwinden schrumpfen.
Durch die Mauer der bischöflichen Gebäude geschützt, sitzt man im Brunnenhof auf der vermutlich längsten Bank des Landes. Man hört dem Wasser beim Plätschern zu und kann seinen Gedanken nachhängen. Eine weitere subtile Intervention der Architekten bestand darin, zwei Stufen einzuschütten. Durch diese Höhenreduzierung gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, in den Brunnen hineinzuschauen: Das fließende Wasser als hör- und sehbares Element ist in die labyrinthhafte Anlage der Stadt zurückgekehrt. Der Brunnenhof wurde solcherart ein Gegenpol zum von Events überfluteten Getümmel des großen Hauptplatzes.
Die Gestaltung des Bodens im historischen Umfeld ist immer eine große Herausforderung. Die Flächen müssen lange haltbar sein, mit der barocken Umgebung harmonieren und dennoch bezahlbar bleiben. Vor Beginn der Umbauarbeiten war der Hof asphaltiert, der neue Belag aus aufgestreutem Sand wurde mit einem Zwei-Komponenten-Harz an den Untergrund gebunden. Die Brunnenerweiterung erfolgte als versickerungsoffene, wassergebundene Decke mit Wachauer Marmor, der Ring um den Brunnenkreis ist ein unbehandelter Stahlring. Obwohl der neue Brunnenhof ein Ort der Ruhe und der vielen Optionen wurde, bleibt er ein Durchzugsraum, und Autos dürfen hie und da auch weiterhin parken – warum auch nicht? Es ist diese mediterrane Gelassenheit, die den Brunnenhof zu einem ganz besonderen Ort macht: einem Ort der Besinnung auf die Tradition, zugleich sehr heutig und zeitgemäß, ein alter neuer Hof in der Stadt.
Spectrum, Mi., 2025.06.04