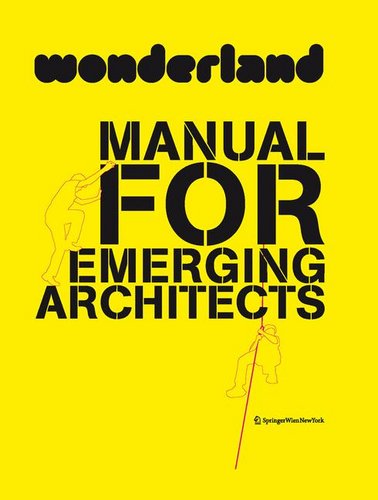Breathe Earth Collective – Natürlich kühlen
Karlheinz Boiger ist Architekt, Partner bei Hohensinn Architektur und Teil des interdisziplinären Breathe Earth Collective, das 2015 den österreichischen Pavillon auf der Expo in Mailand gestaltete. Im Mittelpunkt stand die Klimaleistung des Waldes. Um diese für die Besucher:innen spürbar zu machen, konnte man in dem Expo-Pavillon durch einen echten Wald flanieren.
Es folgten kleinere Pavillons, die das Kollektiv für die Österreich Werbung entwickelte: der Klima Kultur Pavillon für das Kulturjahr in Graz 2020 und kürzlich für Sankt Pölten eine Brunnenskulptur, der sogenannte Windfänger. Im Mittelpunkt seiner Bemühungen steht immer das Interesse, den Hitzeinseln in der Stadt und damit auch dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Karlheinz Boiger erzählt im Gespräch, warum ihn die Klimaleistung des Waldes so fasziniert und wie das Kollektiv eine neue Klimakultur formen und dazu Menschen zum Gespräch und Informationsaustausch zusammenbringen will.
Das Gespräch ist in voller Länge im Podcast Morgenbau anzuhören.
Karlheinz Boiger ist Architekt, Partner bei Hohensinn Architektur und Teil des interdisziplinären Breathe Earth Collective, das 2015 den österreichischen Pavillon auf der Expo in Mailand gestaltete. Im Mittelpunkt stand die Klimaleistung des Waldes. Um diese für die Besucher:innen spürbar zu machen, konnte man in dem Expo-Pavillon durch einen echten Wald flanieren.
Es folgten kleinere Pavillons, die das Kollektiv für die Österreich Werbung entwickelte: der Klima Kultur Pavillon für das Kulturjahr in Graz 2020 und kürzlich für Sankt Pölten eine Brunnenskulptur, der sogenannte Windfänger. Im Mittelpunkt seiner Bemühungen steht immer das Interesse, den Hitzeinseln in der Stadt und damit auch dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Karlheinz Boiger erzählt im Gespräch, warum ihn die Klimaleistung des Waldes so fasziniert und wie das Kollektiv eine neue Klimakultur formen und dazu Menschen zum Gespräch und Informationsaustausch zusammenbringen will.
Das Gespräch ist in voller Länge im Podcast Morgenbau anzuhören.
„Wir vom Breathe Earth Collective haben uns an der TU Graz am Institut für Architektur und Landschaft kennengelernt, wo wir als Lehrbeauftragte gearbeitet haben. Wir waren mit den Studierenden in Istanbul, im Belgrader Wald. Das große Waldgebiet nordöstlich von Istanbul ist die grüne Lunge der Stadt und versorgt sie mit kühler Luft und Wasser. Diese riesige natürliche Ressource der Stadt hat uns fasziniert. Gemeinsam haben wir dann bei der Ausschreibung für den Expo-Pavillon in Mailand mitgemacht. Wir wollten diese Leistung des Waldes in den Mittelpunkt unseres Pavillons stellen und die Architektur mit der Natur verknüpfen. Mit dem Konzept haben wir den Wettbewerb gewonnen. So ist das Breathe Earth Collective entstanden.
Im Zentrum des Expo-Pavillons stand ein echter, lebender Wald. Wir haben ihn technisch unterstützt, mit Sprühnebel angeregt und konnten damit einen Temperaturunterschied von 6 bis 10 Grad gegenüber der Außentemperatur erzeugen. Wir waren selbst erstaunt, dass es so gut funktioniert hat. Das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum wir als Kollektiv weitermachen wollten.
Wir haben im Auftrag der Österreich Werbung mobile Pavillons entwickelt. Das Airship 01 – eine von uns designte Struktur mit einem kleinen Wald im Inneren – wurde in Padua, Mailand und Rom aufgestellt. Vor zehn Jahren wurde der Heat-Island-Effekt noch nicht so breit diskutiert wie heute. Inzwischen spüren wir tagtäglich, dass die Überhitzung in den Städten zu einem großen Problem geworden ist. Wir aber wollten schon damals darauf aufmerksam machen.
Den Begriff der Klimakultur haben wir das erste Mal im Kulturjahr 2020 in Graz verwendet, als wir auf dem Freiheitsplatz den Klima Kultur Pavillon aufgestellt haben. Wir brauchen eine neue Kultur, um mit dem Thema Klima und Klimawandel anders umzugehen. Viele Leute erkennen, dass wir ein großes Problem mit unserem Klima haben, wissen aber nicht, was sie tun sollen. Das Thema ist so global und komplex, dass man sich als einzelner Mensch schwertut, irgendwas zu tun. Wir wollen eine Plattform schaffen, auf der wir über die Themen diskutieren, uns austauschen und gemeinsam Lösungsansätze generieren. Letztlich sind unsere Pavillons ja Versuche, so etwas zu tun. Wir sind nicht nur ein Thinktank, sondern auch ein Dotank. Wir versuchen, dort etwas umzusetzen, wo andere – und das kritisieren wir auch immer ein bisschen – viele Tonnen Papier produzieren. Wir haben nicht mehr 20 Jahre Zeit, Papier zu produzieren, wir müssen ins Tun kommen.
Letztlich sind die Stadt oder die urbanen Ballungsräume die großen Impact-Flächen, wo viel Überhitzung produziert wird. Der öffentliche Raum wird leider nach wie vor zu mehr als 80 Prozent für den ruhenden Verkehr verwendet. Das können wir ändern. Der öffentliche Raum gehört uns allen. Das ist die Fläche, die wir verwenden können, um das Stadtklima zu drehen.“
Karlheinz Boiger ist Architekt und CEO von Hohensinn Architektur. Boiger verbindet klassische Architektur mit innovativen, ökologischen Ansätzen – sichtbar in seiner Mitgründung des interdisziplinären Breathe Earth Collective und dessen internationalen Präsentationen wie in Montreal und Mailand. Für die dortige Expo konzipierte und gestaltete das Breathe Earth Collective 2015 den österreichischen Pavillon.
Es folgten einige kleinere Pavillons für die Österreich Werbung und der Klima Kultur Pavillon in Graz im Kulturjahr 2020.
Zuletzt baute das Breathe Earth Collective gemeinsam mit Hohensinn Architektur in Graz-Reininghaus die unter Denkmalschutz stehende Tennenmälzerei für eine temporäre Nutzung um und verwendete dabei Re-Use-Materialien.
Zum Breath Earth Collective gehören Karlheinz Boiger, Lisa Maria Enzenhofer, Markus Jeschaunig, Andreas Goritschnig und Bernhard König.