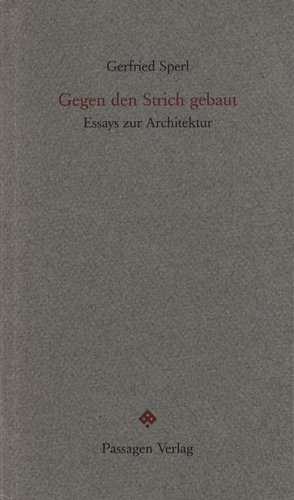Wer braucht die Architektur? Drei prominente Architekten sollten bei einer Diskussion im Rahmen von Graz 2003 diese Frage beantworten. Eine der Thesen: Architektur ist die billigste Bildungseinrichtung, die es gibt. Gerfried Sperl hat moderiert.
Wer braucht die Architektur? Drei prominente Architekten sollten bei einer Diskussion im Rahmen von Graz 2003 diese Frage beantworten. Eine der Thesen: Architektur ist die billigste Bildungseinrichtung, die es gibt. Gerfried Sperl hat moderiert.
Prix: Günther Domenigs Biografie liest sich wie die eines normalen Architekten. Aber nur im ersten Augenblick. Günther Domenig ist manchmal Gebäudebauer und viel mehr als manchmal Architekt. Ich weiß nicht, ob er leidet, wenn man ihn nicht zu den theoretischen Architekten rechnet, aber sicher leidet er nicht, wenn man ihn als Weltmeister des Raumflusses bezeichnet. Denn er gehört eindeutig in die Reihe der österreichischen Architekten der Raumsequenz. Und diese Liste liest sich nicht schlecht. Ich könnte hier bei Fischer von Erlach, Lukas Hildebrandt beginnen, über Kiesler zu Abraham und Hollein kommen. Die barocken Österreicher mit ihren Raumdramaturgien, die sie verbal nie beschreiben können, sind undenkbar in Geld zählenden Gesellschaften.
Günther Domenig baut - katholische Klöster. 1988, schrieb ich einen Text zu seinem Steinhaus. Er heißt „Das Kloster“:
„Er baute wie andere boxen, sein Ring war das von Theodoliten abgesteckte Geviert der Baustelle, sein Gegner das Gebäude, seine Stärke war der fintenreiche Infight, nicht die Distanz. Schwer atmend stand er im Ring, den Kopf in die Papierbrust des Problems gebohrt, schlug er die Haken aus Beton, die Schwinger aus Stahl, die Uppercuts aus der Schulter des Details. Das war nicht elegant, aber ungeheuer kräftig und wirkungsvoll. Er siegte immer vor der Zeit, seine Gebäude waren stehend k.o. In seinem Kloster wird er sich, gekleidet in seinem kostbaren Erinnerungsgewand, umgeben von den Trophäensplittern seiner Siege, eingehüllt von den Chorgesängen seiner Freunde und Jünger zur Ruhe setzen, um seine Wunden zu pflegen und seinen Träumen nachzuhängen. Wir werden ihn besuchen.“
Kada: Wenn Domenig als Künstlerarchitekt bezeichnet wird, kann ich damit einverstanden sein. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Architektur nicht nur das Umsetzen von Funktionen ist, sondern dass Architektur mit einem Mehrwert zu tun hat. Wenn man nachvollziehen kann, was dahinter steckt ab einer gewissen Qualität, dann kann ich mir vorstellen, dass man das mit einer künstlerischen Arbeit verwechseln kann.
Sperl: Es ist immer wieder gerade auch bei Ihnen, den Diskutanten, der Begriff der Utopie im Spiel. Die Behauptung, dass Architektur ganz einfach etwas Prägendes hat und dass sich Architektur niemals herrschenden Tendenzen a priori unterwirft, weist auf diesen utopischen Aspekt. Wolf Prix hat einmal auf die Frage, welche österreichische Architektur aus der Vergangenheit ihn am meisten fasziniert, den Stephansdom genannt. Das ist diese Dimension.
Prix: Natürlich ist Architektur Kunst, aber es ist eine dreidimensionale Kunst. Das heißt, dass die Architektur ein dreidimensionaler Ausdruck unserer Gesellschaften ist. Es gibt die Interpretation der Gesellschaft auf der Ebene der Bankgebäude, die so dastehen wie langweilige Kisten. Auf der anderen Ebene gibt es die Gebäude, die sich mit dem Umfeld unseres Lebens nicht nur beschäftigen, sondern Gefäße dafür sind. Je mehr ein Architekt Künstler ist, umso mehr kann er in seinem Gebäude mehrere Themen variieren. Die Architekten leiden an zwei Krankheiten. Erstens: der vorauseilende Gehorsam, und zweitens: der verinnerlichte Zwang. Ein vorauseilender Gehorsam ist: Der Architekt denkt sich in die Haut des Auftraggebers oder Behörde so sehr hinein, dass er die Codes und Rules vorauseilend befolgt. Verinnerlichter Zwang funktioniert so: Wenn wir was ganz entsetzlich finden und schwer ertragen, macht unsere Psyche das schwer zu Ertragende einfach zur Schönheit. Also wir akzeptieren, was uns eigentlich den Lebensnerv abschneidet. Der Architekt, der heute Kisten baut, und ich sage das so, wie ich es meine - oder wie ich es denke -, leidet unter dem verinnerlichten Zwang. Ob die Kisten aus Glas, aus Stahl oder aus Beton sind, ist egal, denn Architektur hat die Tendenz, frei zu sein. Wenn man die Architektur einsperrt, dann wird sie zu einem eindimensionalen Erlebnis, dann ist sie keine Kunst mehr.
Domenig: Ich gebe im Prinzip dem Wolfgang Prix Recht, ich möchte nur ganz gern eine Sache sagen, wo er nicht Recht hat. Ich habe nie behauptet: Architektur ist Kunst. Was mich interessiert, ist die künstlerische Dimension in der Architektur. Aber ich unterscheide zwischen einem künstlerischen Architekten und einem echten Künstler. Ein Maler und ein Bildhauer hat ja etwas ganz was anderes als Voraussetzung der Freiheit und auch der Belastbarkeit. Ein Architekt leitet die künstlerischen Dinge immer vom Funktionellen oder von organisatorischen Sachen ab.
Kada: Es ist immer gefährlich, wenn die Architekten von sich selber behaupten, sie sind Künstler. Es gibt ganz bestimmte Künstlerarchitekten, die kann man ziemlich genau einteilen und definieren. Wenn man natürlich den Anspruch hat, den Prix hat, dann lass' ich zu, dass ich sage: Architektur ist Kunst. Darum hab ich zuerst gesagt, es ist die Frage, wer das beurteilt und wer Architektur als Kunst bezeichnet oder welcher Architekt seine Arbeit als Kunst bezeichnet. Es ist immer eine Frage, von welchem Standpunkt heraus man den Versuch unternimmt, Architektur als Kunst zu bezeichnen.
Prix: Die Behauptung, dass Architektur Kunst ist, ist ja nicht neu. Nur: Architektur ist Plastik, aber sie hat ein Klo. Diese Architektur, die wir machen, braucht unsere Gesellschaft wie einen Bissen Brot. Wenn wir nicht in der Lage sind, diese Art von Denken zu erlauben, dann schneiden wir uns die Ressourcen der Zukunft ab. Wir brauchen nicht die Gruppenidiotenarchitekturen, wir brauchen auch nicht die ökonomischen Zwangserfüller.
Domenig: Wir müssen immer streiten, wenn wir was Neues machen wollen. Ich weiß, dass mein Steinhaus im höchsten Maß gehasst wird, vor allem in der Gegend, wo es steht. Das will keiner, und ich weiß, dass das Steinhaus wahrscheinlich erst in dreißig Jahren richtig geschätzt wird, nur bin ich da nicht mehr am Leben.
Sperl: Einer der Domenig-Aussprüche lautet: Ich baue, damit die Denkmalpflege auch später etwas zu tun hat.
Domenig: Ja, das hab ich gesagt, an dem gibt es ja nichts auszusetzen. Nur die Denkmalpfleger verstehen das nicht. Das sind die größten Feinde jeder Erneuerung . . .
Kada: Architektur ist die einfachste und billigste Bildungseinrichtung, die die Gesellschaft überhaupt hat. Es ist ein Beweis dafür, wie die Gesellschaft existiert und wie sie existiert hat. Und das zu übersetzen, diese Sprache zu finden, das ist etwas, was die Gesellschaft unbedingt braucht. Das ist das Wichtigste überhaupt, denn sonst ist sie nicht in der Lage, ihre eigene Zeit zu erkennen.
Domenig: Meine Beobachtung an den Hochschulen ist: Jeder schaut in einen PC rein, die können schon keine Bleistifte mehr halten. Es gibt heute so gut wie keinen Architekturstudenten mehr, der mit einer Frau im Bett schläft statt mit einem PC - und umgekehrt. Jeder zweite Muslim hat ein Handy, und jeder dritte Zen-Buddhist fährt einen Toyota, und das ist die Frage, die ich jetzt an den Wolfgang Prix stelle: Die Idee war immer eine Handskizze.
Prix: Es ist natürlich viel komplexer. Das Wort „entwerfen“ beschreibt genau den Zusammenhang, in dem Architektur entsteht. „Ent-“ deutet auf einen unbewussten Vorgang hin, und „werfen“ kommt eindeutig von „Wurf“. Also dieser Moment entscheidet und unterscheidet Architektur von Gebäuden. Die Handzeichnung war für uns und war auch für dich ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt von Entwicklungen. Aber eines will ich schon sagen: Ich bin nicht in der Lage, die dynamischen Kräfte, die die Architektur der nächsten Zeit bestimmen werden, zu zeichnen. Da brauche ich den Computer als Hilfsmittel, das auszudrücken, um was es da geht - allerdings gibt es ein nach wie vor entscheidendes, dem Architekten nicht zu nehmendes Werkzeug, das ist das Auge. Das Auge und die Entscheidung, das ist die Form aus dieser Vielfalt von Formen bei der Verformung durch dynamische Kräfte. Das Auge kann den Bleistift ersetzen, aber nicht den Architekten.
Sperl: Wolf Prix hat einmal Herman Melville zitiert, und zwar den Satz: „Ich wollte, der Wind hätte einen Körper.“ Das hängt mit einem anderen Satz zusammen: Räume sollten sich wie Wolken verändern können.
Prix: Dass die Gesellschaft bei diesen Ideen nicht mitgemacht hat, wäre ein Beweis dafür, dass Architektur manchmal Grenzen sprengt. Aber: Es ist wichtig, dass es solche Ansätze gibt, um irgendwann einmal sagen zu können: Das wurde schon gedacht.
Domenig: Der Wolfi Prix war immer ein Provokateur. Ich bin '80 auf die Hochschule gekommen. Die Einstiegseinladung hab ich auch den Himmelblaus und Prix gegeben. Da hat er schon wieder ein Zitat erfunden: „Architektur muss brennen.“ Und dann haben wir - ich habe natürlich alles finanziert - ein riesiges Feuermal im Hof drinnen inszeniert. Da wäre fast die ganze Architekturfakultät abgebrannt.
Sperl: Alle drei, Domenig, Prix und Kada, sind mehr oder weniger seit Jahren international tätig. Was heißt das überhaupt, international zu arbeiten?
Kada: Developer entwickeln ein Bauwerk nicht deshalb, damit er Architektur produziert, sondern damit sie Kapital produzieren. Dass sie dabei vergessen, dass mit Architektur sehr viel Geld zu verdienen ist, ist ein weltweites Problem. Es gibt einige Leute, die interessiert daran sind, es gibt vielleicht auch Institutionen, die interessiert daran sind, und es gibt auch ganz spezifische Bauherren, die interessiert daran sind, Architektur als Transportmittel zu verwenden. Nur: Wenn man beispielsweise die EU-Richtlinien anschaut, da kommt Architektur so wenig vor wie der Begriff „Kanaldeckel“. Kultur oder Architektur ist auch international immer nur eine Angelegenheit von wenigen, die erkannt haben, was das eigentlich sein kann. Wir sind ständig in der Zwickmühle, d. h. auf der einen Seite echte Architektur zu produzieren und auf der anderen Seite Geld zu verdienen, damit man das Büro über die Runden bringt.
Prix: Wir bauen in Amerika, wir bauen in Frankreich, wir bauen in der Dänemark, in Doha, also wirklich fast überall. Wir haben große Schwierigkeiten mit den Rechtssystemen in den einzelnen Ländern, und wir haben auch große Schwierigkeiten mit der Baukultur in den einzelnen Ländern. Wir brauchen tatsächlich pro Land einen eigenen Rechtsanwalt. Wir brauchen eigene Projektmanagementgruppen. Und da zeigen sich verschiedene Bedingungen und Chancen: Holland beispielsweise hat junge Architekten bis zu einem gewissen Projektstatus unterstützt, der Staat hat die Architekten unterstützt. Und zwar in Form von tatsächlicher finanzieller Unterstützung für internationale Wettbewerbe. Dieser Support, der von den Politiker immer wieder gern behauptet wird, ist in Wirklichkeit nicht vorhanden. Es ist auch in Österreich keine Theorieschule vorhanden, die die Qualität der Österreicher wirklich präzise im internationalen Feld positionieren könnte. Das ist ein ganz, ganz großer Nachteil unserer heterogenen Szene.
[Bei einem „Fest für Günther Domenig“ am 19. Juli im Kunsthaus Mürzzuschlag diskutierte dieser mit Wolf Prix und - zugeschaltet auf einer Videowand aus dem „Dom im Berg“ in Graz - mit Klaus Kada. Moderiert und redigiert hat Gerfried Sperl.
„Günther Domenig baut, wie andere boxen“
Wolfgang Prix
„Es ist immer gefährlich, wenn Architekten sagen, sie sind Künstler“
Klaus Kada
„Wir müssen immer streiten, wenn wir was Neues machen wollen“
Günther Domenig]
Der Standard, Sa., 2003.08.16